Mehrwertsteuerliche Behandlung von EU-finanzierten Projekten für gemeinnützige Vereinigungen

Zusammenfassung
🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
Der Streit zwischen dem lettischen Verband für Informations- und Kommunikationstechnologie (der Verband) und der staatlichen Steuerbehörde wirft die Frage auf, wann eine gemeinnützige Organisation die Grenze zur wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des EU-Mehrwertsteuerrechts überschreitet. Im Mittelpunkt dieses Falles stehen zwei von der EU finanzierte Ausbildungsprojekte, die vom Verband verwaltet, aber hauptsächlich von Unterauftragnehmern durchgeführt und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert werden.
Der Fall untersucht die Überschneidung von EU-Mehrwertsteuerrecht, gemeinnütziger Tätigkeit und der Verwaltung öffentlicher Zuschüsse und klärt, ob und wann eine Vereinigung durch ihre Vermittlerrolle zu einem Wirtschaftsbeteiligten im Sinne der Mehrwertsteuer wird.
Hintergrund des Falles
Im Jahr 2016 schloss der lettische Verband zwei Verträge mit der Zentralen Finanz- und Vertragsagentur (CFLA) zur Durchführung von EFRE-finanzierten Schulungsprojekten ab. Es handelte sich um zwei Projekte, eines für IKT-Fachleute und eines für Kleinst- und Kleinunternehmen (KKU).
Für das erste Projekt, das für IKT-Fachleute entwickelt wurde, übernahm der Verband die Ausbildungskosten zuzüglich der Mehrwertsteuer und in einigen Fällen auch Verwaltungsgebühren in Höhe von 5 % oder 10 % der vom CFLA erhaltenen Mittel. Der Verband ernannte Ausbilder für die Durchführung von Kursen, übernahm deren Kosten, einschließlich der Mehrwertsteuer, und machte die Mehrwertsteuer als Vorsteuer geltend. Nach Abschluss der Ausbildung oder des Kurses erstattete der Verband den Empfängern einen Teil der Ausbildungskosten mit Mitteln aus der CFLA und stellte ihnen die Verwaltungsgebühren in Rechnung.
Beim zweiten Projekt, das sich an KKU richtete, übernahm der Verband die gesamten Gebühren der Schulungsanbieter, einschließlich der Mehrwertsteuer, im Rahmen von Verträgen mit den Begünstigten, die sich bereit erklärten, 30 % der Gesamtkosten zu kofinanzieren. Der EFRE stellte über den CFLA 70 % der Zahlungen zur Verfügung. Dies bedeutete, dass der Verein die Zahlungen und die Abwicklung der Mehrwertsteuer verwaltete und so sicherstellte, dass die Finanzierungs- und Kofinanzierungsverpflichtungen erfüllt wurden, während die Ausbildungsleistungen erbracht wurden.
Im Anschluss an die Steuerprüfung stellte die lettische Steuerbehörde die Berechtigung des Vereins zum Vorsteuerabzug in Frage. Die Steuerbehörde erließ acht Bescheide für die Jahre 2019 bis 2021, in denen sie die Vereinigung aufforderte, 87.299,37 EUR Mehrwertsteuer für den Zeitraum von Januar bis Oktober 2018 zu zahlen, sowie eine Geldstrafe von 611,96 EUR und Säumniszuschläge von 7.707,52 EUR. Darüber hinaus lehnte die Steuerbehörde die Anträge der Vereinigung auf Erstattung von zu viel gezahlter Mehrwertsteuer für verschiedene Monate in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von insgesamt 101.363,24 EUR ab.
Der Hauptgrund dafür war die Schlussfolgerung der Steuerbehörde, dass die IKT- und KKU-Projekte nur von einem Verein oder einer öffentlichen Behörde und nicht von einem Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden können. Da der Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgte und die Ausbildungsleistungen nicht selbst erbrachte, stellte seine Tätigkeit keine wirtschaftliche Tätigkeit dar. Folglich könne der Verein nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein.
Demgegenüber vertrat der Verband die Auffassung, dass seine Rechtsstellung als Verein seine Rechte im Bereich der Mehrwertsteuer nicht berühre, dass er als Steuerpflichtiger in Lettland registriert sei und dass er durch die IKT- und KKU-Projekte als Vermittler von Ausbildungsleistungen auftrete, was ihn zum Vorsteuerabzug berechtigen sollte. Daher focht der Verband die Schlussfolgerung und Entscheidung der Steuerbehörden vor dem Bezirksverwaltungsgericht an.
Das Bezirksverwaltungsgericht hob die angefochtenen Entscheidungen auf und entschied zugunsten des Verbandes. Die Steuerbehörde legte jedoch gegen die Aufhebung Berufung beim regionalen Verwaltungsgericht ein, das alle diesbezüglichen Fälle zusammenfasste. Da die Steuerbehörde unsicher war, wie die EU-weiten MwSt-Vorschriften auszulegen sind, ersuchte sie den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine Vorabentscheidung.
Die wichtigsten Fragen aus dem Ersuchen um Vorabentscheidung
Das regionale Verwaltungsgericht legte dem EuGH drei Fragen vor. Die erste Frage lautete, ob eine gemeinnützige oder nicht gewinnorientierte Organisation, die aus dem EFRE finanzierte Projekte durchführt, als Steuerpflichtiger anzusehen ist, der eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie ausübt.
Die zweite Frage betrifft die Frage, ob nach der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, insbesondere Artikel 28, ein Verein, der nicht unmittelbar Ausbildungsleistungen erbringt, dennoch als Leistungserbringer angesehen werden kann, wenn er diese Leistungen von einem anderen Wirtschaftsteilnehmer zur Durchführung eines aus dem EFRE finanzierten Projekts erwirbt.
Und schließlich wollte das Landesverwaltungsgericht wissen, ob die Steuerbemessungsgrundlage für eine Dienstleistung der Gesamtbetrag ist, der sowohl vom Leistungsempfänger als auch von einem Dritten gezahlt wird, wenn der Leistungsempfänger nur einen Teil der Kosten der Dienstleistung trägt und der Rest aus EFRE-Mitteln finanziert wird.
Anwendbarer Artikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
Der EuGH bezeichnete fünf Artikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie als die wichtigsten, von denen drei in den Fragen direkt genannt wurden. Diese Schlüsselartikel für diesen Fall waren Artikel 2(1), 9(1), 28, 73 und 132(1).
Die Artikel 9 Absatz 1, 28 und 73 waren Teil der dem EuGH vorgelegten Frage. Sie definieren den Begriff des Steuerpflichtigen, betonen, dass er, wenn er in eigenem Namen, aber für Rechnung eines anderen handelt und an der Erbringung von Dienstleistungen beteiligt ist, als Empfänger und Erbringer dieser Dienstleistungen gilt, und legen fest, dass die Steuerbemessungsgrundlage für die Lieferung von Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleistungen alle vom Kunden oder einem Dritten erhaltenen oder zu erhaltenden Gegenleistungen umfasst, einschließlich der unmittelbar mit dem Preis der Dienstleistung verbundenen Subventionen.
Die Artikel 2 Absatz 1 und 132 Absatz 1 waren nicht Gegenstand der Fragen. Da sie jedoch festlegen, dass die Mehrwertsteuer auf die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt oder eine Gebühr innerhalb eines EU-Landes anwendbar ist, wenn sie von einem Steuerpflichtigen erbracht werden, der als solcher handelt, und die Mehrwertsteuerbefreiung für bestimmte Umsätze, einschließlich Berufsbildungs- oder Umschulungsdienstleistungen sowie eng damit zusammenhängender Gegenstände, festlegen, wenn sie von Einrichtungen des öffentlichen Rechts mit diesem Zweck oder von anderen Organisationen erbracht werden, die von dem EU-Land als Einrichtungen mit ähnlichen Zielen anerkannt sind, waren diese Bestimmungen für den Fall entscheidend.
Lettlands nationale MwSt-Vorschriften
In Bezug auf die lettischen Vorschriften stellte der EuGH fest, dass das Mehrwertsteuergesetz vom 29. November 2012 die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie in lettisches Recht umsetzt und dass die Artikel 2 Absatz 1 und 7 Absatz 1 des Gesetzes über Vereine und Stiftungen für diesen Fall am wichtigsten sind.
Bedeutung des Falles für Steuerpflichtige
Die Auslegungen und Analysen des EuGH geben den Steuerpflichtigen klare Hinweise darauf, wie die EU-Mehrwertsteuervorschriften gemeinnützige Organisationen behandeln, die als Vermittler bei der Erbringung von mit öffentlichen Zuschüssen finanzierten oder kofinanzierten Dienstleistungen auftreten.
Die Feststellungen und Schlussfolgerungen des Urteils können erhebliche finanzielle und steuerliche Auswirkungen für Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen haben, die an öffentlichen Projekten beteiligt sind, insbesondere an solchen, die mit EU-Mitteln kofinanziert werden, da sie zum Abzug der Vorsteuer auf Kosten berechtigt sind, die bei der Durchführung solcher Projekte anfallen.
Analyse der Feststellungen des Rechnungshofs
Zu Beginn der Analyse der Rechtssache stellte der EuGH fest, dass es zweckmäßiger wäre, sich zunächst mit der zweiten Frage zu befassen, da deren Beantwortung klären kann, ob Subventionen, wie sie vom EFRE über den CFLA gezahlt werden, in die Steuerbemessungsgrundlage für die von der Vereinigung im Rahmen der IKT- und KKU-Projekte erbrachten Dienstleistungen einbezogen sind. Je nach der Antwort auf diese Frage wird anschließend die erste Frage zur wirtschaftlichen Tätigkeit geprüft.
Der EuGH ging auf die zweite Frage ein und stellte fest, dass es Sache des regionalen Verwaltungsgerichts ist, den tatsächlichen Charakter der Umsätze im Ausgangsverfahren zu beurteilen. Dennoch wird der EuGH bei der Auslegung der EU-Verordnungen helfen, den Fall zu lösen.
Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Dienstleistung nur dann steuerpflichtig, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den erbrachten Dienstleistungen und dem vom Steuerpflichtigen erhaltenen Entgelt besteht. Der erforderliche Zusammenhang ist gegeben, wenn zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger ein gegenseitiges Rechtsverhältnis besteht und das vom Leistungserbringer vereinnahmte Entgelt ein tatsächliches Entgelt für die an diesen Empfänger erbrachten Dienstleistungen darstellt.
Gemäß Artikel 73 ist es nicht erforderlich, dass die Zahlung direkt vom Dienstleistungsempfänger kommt; die Zahlung des Entgelts kann auch von einem Dritten erfolgen. Auch die Tatsache, dass der gezahlte Preis von den Kosten oder dem Marktwert abweicht, ist für die Feststellung, ob es sich um ein Entgelt handelt oder nicht, unerheblich. Der Hauptgrund für eine solche Auslegung ist, dass sie den direkten Zusammenhang zwischen der erbrachten Dienstleistung und dem erhaltenen Entgelt, der im Voraus nach genauen Kriterien festgelegt wird, nicht berührt.
Der EuGH kam zu dem Schluss, dass bei dem IKT-Projekt zwei Leistungsbeziehungen bestehen. Die erste besteht zwischen dem Begünstigten und dem Verband, wobei der Begünstigte den vollen Preis zahlt und später eine teilweise Rückerstattung aus dem CFLA-Zuschuss erhält. Das zweite besteht zwischen dem Verband und dem beauftragten Ausbildungsunternehmen, für das der Verband die Dienstleistungen bezahlt. Aus dieser Struktur geht hervor, dass der Verband als Erbringer der Ausbildungsleistungen für die Begünstigten angesehen wird, unabhängig davon, dass er Unterauftragnehmer anstelle seines eigenen Personals einsetzt.
Mit anderen Worten, der Verband handelte in eigenem Namen und in eigenem Auftrag, indem er den Empfängern die Kosten für die Ausbildung in Rechnung stellte. Im Gegensatz dazu arbeitete das Ausbildungsunternehmen im Namen des Vereins und erbrachte die Dienstleistungen, für die der Verein dann bezahlte.
Beim KKU-Projekt, so der EuGH weiter, gibt es einen kleinen Unterschied zum IKT-Projekt. In diesem Fall besteht ein Vertrag zwischen dem Verband und einem Unterauftragnehmer über die Durchführung von Schulungen. Die Beziehung zu den Ausbildungsempfängern wird jedoch durch eine separate dreiseitige Vereinbarung zwischen dem Verband, dem Ausbildungsunternehmen und jedem Empfänger geregelt.
Der EuGH kam zu dem Schluss, dass der Verband bei der Durchführung dieses Projekts die Ausbildungsleistungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung über einen Unterauftragnehmer erbracht hat, da der Unterauftragnehmer nicht in eigenem Namen gehandelt hat. Daher ist Artikel 28 in diesem Fall nicht anwendbar.
Die abschließende Bemerkung des EuGH zur zweiten Frage lautete, dass die Tatsache, dass die Finanzierung der Ausbildungsdienstleistungen in erster Linie von der CFLA stammt, die ihrerseits die Mittel aus dem EFRE erhalten hat, nicht verhindert, dass die Dienstleistungen als gegen Entgelt erbracht eingestuft werden, da nach ständiger Rechtsprechung ein Entgelt von einem Dritten stammen kann. Die Tatsache, dass die Mittel die Kosten des Vereins vollständig decken, ohne einen Gewinn zu erwirtschaften, was mit seinem Status als gemeinnütziger Verein vereinbar ist, steht der Einstufung der Dienstleistungen als entgeltlich nicht entgegen.
In Bezug auf die dritte Frage war die Analyse des EuGH kurz und bündig. Er stellte fest, dass auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung und des vorliegenden Sachverhalts die Frage zu bejahen ist.
Nach der Beantwortung der zweiten und dritten Frage kehrte der EuGH zur ersten Frage zurück. Gleich zu Beginn der Analyse dieser Frage stellte der EuGH fest, dass vorbehaltlich der tatsächlichen Würdigung durch das vorlegende Gericht die Erbringung von Ausbildungsdienstleistungen die Kriterien für die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt, d. h. gegen Entgelt, gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c erfüllt, was eine notwendige Voraussetzung für eine wirtschaftliche Tätigkeit ist.
Der EuGH fügte hinzu, dass die Tatsache, dass ein Unternehmen eine gewerbliche Tätigkeit nur nebenbei ausübt, nicht ausschließt, dass die Tätigkeit als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen wird, wenn sie auf die Erzielung kontinuierlicher Einnahmen abzielt. Auch die erhebliche Finanzierung der Fortbildungskurse durch den EFRE berührt nicht die Frage, ob es sich bei der Tätigkeit des Vereins um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, da der Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit objektiv und unabhängig von der Finanzierungsquelle des Betreibers, einschließlich öffentlicher Zuschüsse, zu beurteilen ist.
Schließlich betonte der EuGH, dass die Bestimmung der wirtschaftlichen Tätigkeit eine Einzelfallprüfung aller Umstände erfordert, bei der das Verhalten mit dem eines typischen aktiven Unternehmens in dem betreffenden Bereich verglichen wird. Im vorliegenden Fall muss der Verein mit einer Organisation verglichen werden, die Ausbildungsdienstleistungen vermittelt und anbietet.
Endgültige Entscheidung des Gerichts
Der EuGH entschied, dass nach den Bestimmungen der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie die Erbringung von Schulungsdienstleistungen, die von einem gemeinnützigen Verein in Rechnung gestellt werden, eine entgeltliche oder unentgeltliche Dienstleistung darstellt und dass Artikel 28 nicht anwendbar ist, wenn kein ausdrücklicher Geschäftsbesorgungsvertrag vorliegt, aus dem hervorgeht, dass ein Steuerpflichtiger die Dienstleistungen im eigenen Namen für Rechnung eines anderen erbringt.
Die Zuschüsse, die einem Dienstleistungserbringer von einem europäischen Fonds für eine bestimmte Dienstleistung gezahlt werden, sind in der Steuerbemessungsgrundlage als Gegenleistung oder als von einem Dritten erhaltenes Entgelt enthalten. Und schließlich hindert die Gemeinnützigkeit einer Vereinigung nicht daran, als Steuerpflichtiger angesehen zu werden, der eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, sofern die Tätigkeit unter Berücksichtigung aller Umstände die objektiven Kriterien einer wirtschaftlichen Tätigkeit erfüllt.
Schlussfolgerung
Der EuGH verschaffte gemeinnützigen Organisationen, die als Vermittler in EU-finanzierten Projekten tätig sind, entscheidende Klarheit und unterstrich, dass der Status der Gemeinnützigkeit nicht verhindert, dass eine Vereinigung nach dem EU-Mehrwertsteuerrecht als Steuerpflichtiger gilt, sofern sie Tätigkeiten ausübt, die die objektiven Kriterien einer wirtschaftlichen Tätigkeit erfüllen.
Eine weitere Erkenntnis aus diesem Fall ist, dass Dienstleistungen, die durch Unterauftragnehmer erbracht werden, selbst wenn sie hauptsächlich durch öffentliche Subventionen wie EFRE-Zuschüsse finanziert werden, eine Dienstleistung gegen Entgelt oder eine Gebühr darstellen können, was erhebliche mehrwertsteuerliche Verpflichtungen für diejenigen mit sich bringt, die an solchen Projekten und Aktivitäten beteiligt sind.
Quelle: Rechtssache C-87/23 - Lettischer Verband für Informations- und Kommunikationstechnologie / Staatliche Steuerbehörde, EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, Mehrwertsteuerüber

Ausgewählte Einblicke
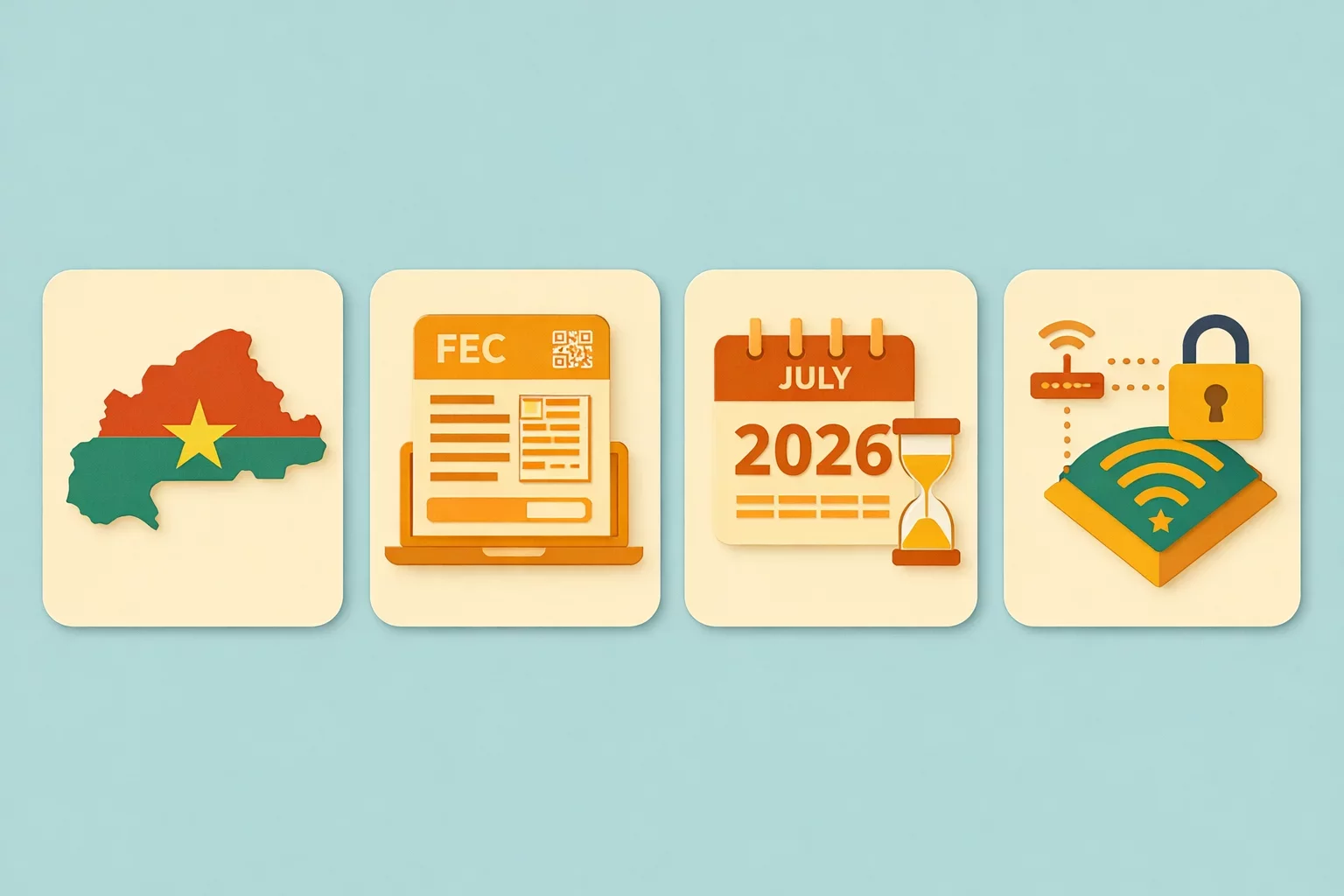
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Lettland
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)

-ooimnrbete.webp)
.png)

