Appstore VAT Ruling: Wem gehört die Steuer für In-App-Käufe? C-101/24

Umsatzsteuerpflicht für elektronisch erbrachte Dienstleistungen über digitale Plattformen
Zusammenfassung
1. The application of the Article 28 commissionaire fiction is not excluded merely because post-purchase order confirmations provided to non-taxable customers named the developer as the supplier and included the developer's domestic VAT rate.
2. If the Article 28 fiction applies, the place of supply for the resulting fictional service from the developer to the Appstore operator must be determined according to the B2B rule found in Article 44 of the VAT Directive.
3. Article 203 (VAT on invoice) is inapplicable for transactions involving non-taxable end-customers because there is no threat to tax revenue arising from the right to deduct input tax.
🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
1.0 Identifizierung des Falles
Name der Rechtssache: | Finanzamt Hamburg-Altona vs. Xyrality GmbH |
Aktenzeichen: | C-101/24 |
Gericht: | Gerichtshof der Europäischen Union (Erste Kammer) |
Datum des Urteils: | 9. Oktober 2025 |
Kernrechtsgebiet: | EU-Mehrwertsteuer, elektronisch erbrachte Dienstleistungen |
2.0 Sachlicher Hintergrund
In diesem Fall geht es um die komplexe Frage, wer die Mehrwertsteuer (MwSt) schuldet, wenn digitale Dienstleistungen über eine Online-Plattform an Verbraucher verkauft werden. In diesem Abschnitt wird die geschäftliche Vereinbarung zwischen dem Anwendungsentwickler (Xyrality), dem Plattformbetreiber ("X") und dem Endkunden skizziert, die die Grundlage für den Rechtsstreit über die Mehrwertsteuerpflicht bildete.
Der Kernsachverhalt des Falles im relevanten Zeitraum von 2012-2014 ist wie folgt:
Beteiligte Parteien: An dem Rechtsstreit beteiligt waren die Xyrality GmbH, ein deutscher Spieleentwickler,"X", ein irisches Unternehmen, das einen großen App-Store betreibt, und Endkunden, bei denen es sich um Nichtsteuerpflichtige (d. h. private Verbraucher) handelt.
Geschäftsmodell: Xyrality entwickelte und vertrieb kostenlose Handyspiele. Die Einnahmen wurden durch "In-App-Käufe" erzielt, bei denen die Spieler virtuelle Gegenstände oder Vorteile kaufen konnten, um ihr Spiel zu verbessern.
Transaktionsablauf: Wenn sich ein Kunde für einen In-App-Kauf entschied, erschien eine Reihe von drei Pop-up-Fenstern innerhalb des Spiels. In diesen Fenstern wurden das Produkt, der Preis und die Zahlungsmethode angezeigt und der Nutzer durch die Bestätigung geführt. Entscheidend ist, dass diese Pop-up-Fenster ausschließlich das Logo des App-Stores zeigten; während des eigentlichen Kaufvorgangs wurde Xyrality als Anbieter nicht erwähnt.
Kommunikation nach dem Kauf: Nach Abschluss der Transaktion erhielt der Endkunde eine E-Mail-Bestätigung vom App-Store-Betreiber (X). Diese E-Mail enthielt eine kritische Information: Sie besagte, dass der Kauf bei Xyrality getätigt wurde und enthielt die deutsche Mehrwertsteuer in der Preisaufschlüsselung.
Kommerzielle Bedingungen: Der Betreiber des App-Stores (X) behielt eine Provision von 30 % der durch alle In-App-Käufe erzielten Einnahmen und überwies die restlichen 70 % an Xyrality.
Diese Betriebsstruktur, insbesondere die widersprüchlichen Informationen, die dem Kunden während und nach dem Kauf präsentiert wurden, führten zu Unklarheiten über die korrekte mehrwertsteuerliche Behandlung und führten zu der anschließenden Anfechtung.
3.0 Verfahrensgeschichte
Die strategische Bedeutung dieses Falles wird durch seine Verfahrensgeschichte unterstrichen, die die Entwicklung der rechtlichen Argumente von den ersten Steueranmeldungen über das deutsche Gerichtssystem bis hin zur letztendlichen Anrufung des höchsten Gerichts der EU nachzeichnet. Dieser Weg offenbart die grundlegende Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuerpflicht in der digitalen Plattformökonomie.
Xyralitys ursprüngliche Position und Korrektur: Xyrality meldete zunächst deutsche Mehrwertsteuer auf seine In-App-Verkäufe an und führte sie ab, da es davon ausging, dass es der direkte Lieferant der Endkunden war. Am 29. Januar 2016 reichte das Unternehmen jedoch berichtigte Steuererklärungen für 2012-2014 ein. Es argumentierte, dass seine Vereinbarung mit dem irischen App-Store-Betreiber (X) ein "Kommissionsgeschäft" gemäß Artikel 28 der Mehrwertsteuerrichtlinie darstelle. Nach dieser Auffassung erbrachte Xyrality Dienstleistungen an die irische Plattform (eine in Deutschland nicht steuerbare Leistung), die ihrerseits als Lieferant an die Endkunden galt.
Beurteilung des Finanzamtes: Das deutsche FinanzamtHamburg-Altona lehnte die berichtigten Steuererklärungen von Xyrality ab. Es vertrat die Auffassung, dass der App-Store lediglich ein Zwischenhändler sei und Xyrality der direkte Lieferant an die Endkunden bleibe. Das Finanzamt argumentierte, da der Endkunde bei jedem Schritt des Kaufs auf die Geschäftsbedingungen hingewiesen werde, sei klar, dass die Plattform die Transaktion lediglich für eine andere Partei ermögliche. Daher unterlägen die Umsätze der deutschen Umsatzsteuer.
Urteil des Finanzgerichts Hamburg: Xyrality legte gegen den Bescheid des Finanzamts Einspruch ein und setzte sich vor demFinanzgericht Hamburg durch. Das Gericht entschied zugunsten von Xyrality und stellte fest, dass der App-Store-Betreiber (X) "in eigenem Namen" gehandelt hat. Zur Begründung verwies es auf die Wahrnehmung des Durchschnittskunden, der den App-Store aufgrund des dominanten Brandings in der Kaufoberfläche und der Verpflichtung, die Nutzungsbedingungen der Plattform zu akzeptieren, als seinen Vertragspartner ansehen würde.
Berufung und Verweisung: Das Finanzamt legte gegen diese Entscheidung Revision beim Bundesfinanzhof ein. Der Bundesfinanzhof wies darauf hin, dass nach seiner ständigenLaden-Rechtsprechung" ein Kunde im Allgemeinen davon ausgeht, dass er einen Vertrag mit dem Ladenbesitzer und nicht mit dem zugrunde liegenden Produktanbieter abschließt. In Anbetracht der EU-weiten Auswirkungen und der Notwendigkeit einer kohärenten Auslegung der MwSt-Richtlinie legte er dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) jedoch drei konkrete Fragen zur Vorabentscheidung vor.
Dieser Verfahrensweg hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der EuGH die Anwendung grundlegender EU-Mehrwertsteuerprinzipien auf moderne digitale Lieferketten klären kann.
4.0 Vorabentscheidungsfragen
In diesem Abschnitt werden die konkreten Rechtsfragen vorgestellt, die der Bundesfinanzhof dem EuGH vorgelegt hat. Diese Fragen zielten darauf ab, die zentralen Unklarheiten bei der Anwendung der Mehrwertsteuerrichtlinie auf die komplexen, vielschichtigen Transaktionen, die auf digitalen Plattformen üblich sind, zu klären.
Mit diesen Fragen sollte der EuGH endgültig klären, wie die Mehrwertsteuervorschriften in diesem Szenario auszulegen und anzuwenden sind.
5.0 Urteil des Gerichtshofs (Rechtsbestand)
Dieser Abschnitt enthält die unmittelbaren und abschließenden Antworten des EuGH auf die Vorlagefragen. Die Urteile des Gerichtshofs schaffen einen klaren Rahmen für die Bestimmung der Mehrwertsteuerschuld bei ähnlichen plattformbasierten Umsätzen.
Zur Anwendung von Artikel 28: Der Gerichtshof stellte fest, dass die Anwendung von Artikel 28 (der die Plattform als fiktiven Lieferer behandelt) nicht allein deshalb ausgeschlossen ist, weil eine nachträgliche Bestätigung den Entwickler als Lieferer ausweist. Die Realität der Transaktion selbst hat Vorrang.
Zum Ort der Lieferung (Artikel 44): Der Gerichtshof stellte fest, dass sich im Falle der Anwendung von Artikel 28 der Ort der fiktiven Lieferung vom Entwickler an den App-Store nach Artikel 44 der MwSt-Richtlinie bestimmt. Dies bedeutet, dass der Ort der Lieferung dort liegt, wo der Leistungsempfänger (der Betreiber des App-Stores) ansässig ist.
Zur Mehrwertsteuerpflicht (Artikel 203): Der Gerichtshof entschied, dass der Entwickler gemäß Artikel 203 (Haftung für die in einer Rechnung ausgewiesene Mehrwertsteuer) nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Artikels sind nicht erfüllt, da der Kunde ein Nichtsteuerpflichtiger ist, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, so dass kein Risiko für das Steueraufkommen besteht.
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der detaillierten rechtlichen Argumentation, die diesen endgültigen Urteilen zugrunde liegt.
6.0 Argumentation und Analyse des Gerichtshofs
In diesem Abschnitt wird die juristische Logik des Gerichtshofs für jedes seiner Urteile analysiert. Er liefert die analytische Grundlage für das Urteil und klärt die Auslegung der wichtigsten Artikel der MwSt-Richtlinie für digitale Plattformen und bietet entscheidende Einblicke in den Ansatz des Gerichtshofs, der dem Inhalt Vorrang vor der Form einräumt.
6.1 Analyse von Frage 1: Der App-Store als fiktiver Anbieter (Artikel 28)
Der Gerichtshof bejahte, dass der App-Store als fiktiver Lieferant im Sinne von Artikel 28 behandelt werden sollte. Er stützt sich dabei auf die folgenden Grundsätze:
Vorrang der Transaktionswirklichkeit: Entscheidend für die Anwendung von Artikel 28 ist, ob der Vermittler (die Plattform) aus Sicht des Kunden "in eigenem Namen" handelt. Der Gerichtshof betonte, dass die Wahrnehmung des Kunden während der Transaktion ausschlaggebend ist. In diesem Fall interagierte der Nutzer nur mit der Schnittstelle des App-Stores, sah dessen Branding und akzeptierte dessen Bedingungen. Dadurch wurde die wirtschaftliche Realität geschaffen, dass der App-Store der Vertragspartner war.
Irrelevanz der postfaktischen Informationen: Das Hauptargument des Gerichts lautete, dass Informationen, die nach einem rechtlich abgeschlossenen Kauf bereitgestellt werden, die Art der Transaktion nicht rückwirkend ändern können. Die E-Mail-Bestätigung, die nach Abschluss des Kaufs versandt wurde, wurde als unzureichend erachtet, um die während des Kaufvorgangs selbst festgestellten Tatsachen außer Kraft zu setzen.
Klärung der Rolle der Durchführungsverordnung 9a: Der Gerichtshof verwies auf Artikel 9a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung. Obwohl dieser Artikel, der den Grundsatz des "deemed supplier" für App-Stores kodifiziert, erst am 1. Januar 2015 (nach dem Streitzeitraum) in Kraft trat, betrachtete der Gerichtshof ihn als eine Klarstellung der bereits bestehenden Grundsätze des Artikels 28. Dies bestärkte ihn in seiner Auslegung, dass die Plattform bereits vor dem förmlichen Inkrafttreten der neuen Vorschriften als Anbieter galt.
6.2 Analyse von Frage 2: Die zweistufige Fiktion und der Ort der Lieferung (Artikel 44)
Der Gerichtshof hat klargestellt, wie der Ort der Dienstleistung innerhalb der durch Artikel 28 geschaffenen Struktur des "Kommissionsgeschäfts" zu bestimmen ist. Seine Logik folgt einer klaren, zweistufigen Analyse.
Erstens schafft Artikel 28 die rechtliche Fiktion von zwei verschiedenen, aufeinander folgenden Lieferungen:
Lieferung 1: Vom Entwickler (Xyrality) an den App-Store (X).
Lieferung 2: Vom App-Store (X) an den Endkunden.
Zweitens vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass die mehrwertsteuerliche Behandlung der einzelnen Leistungen unabhängig voneinander zu bestimmen ist. Bei der Lieferung 1 handelt es sich um einen Umsatz zwischen zwei Steuerpflichtigen (B2B). Daher gilt die allgemeine B2B-Regel des Ortes der Dienstleistung in Artikel 44. Diese Regel besagt, dass die Dienstleistung dort erbracht wird, wo der Empfänger seinen Geschäftssitz hat - in diesem Fall Irland, wo der Betreiber des App-Stores ansässig war.
Entscheidend ist, dass der Gerichtshof festgestellt hat, dass die Art von Lieferung 2 (ein B2C-Umsatz) keinen Einfluss auf die mehrwertsteuerliche Behandlung des separaten B2B-Umsatzes in Lieferung 1 hat.
6.3 Analyse von Frage 3: Der begrenzte Anwendungsbereich der Haftung für fehlerhafte Rechnungen (Artikel 203)
Der Gerichtshof stellte fest, dass Artikel 203 nicht anwendbar ist, wodurch Xyrality von der Haftung für die in den Bestätigungs-E-Mails genannte deutsche Mehrwertsteuer befreit ist. Die Argumentation war präzise und zielgerichtet:
Zweck von Artikel 203: Der Gerichtshof wies erneut darauf hin, dass der Hauptzweck dieses Artikels darin besteht, jedes Risiko für das Steueraufkommen auszuschließen. Ein solches Risiko entsteht, wenn der Empfänger einer Rechnung die vom Absender zu Unrecht in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer zu Unrecht abzieht.
Kein Risiko: In diesem Fall waren die Endkunden nicht steuerpflichtige private Verbraucher. Als solche haben sie kein Recht auf Vorsteuerabzug.
Schlussfolgerung: Da die Möglichkeit eines missbräuchlichen Vorsteuerabzugs durch den Empfänger nicht gegeben war, bestand auch kein entsprechendes Risiko für das Steueraufkommen. Daher war die Grundvoraussetzung für die Anwendung von Artikel 203 nicht erfüllt.
Die ausführliche Argumentation des Gerichtshofs bietet einen soliden Rechtsrahmen, der sich unmittelbar in bedeutenden praktischen Konsequenzen für die digitale Wirtschaft niederschlägt.
7.0 Wichtige Auswirkungen für Steuerfachleute und digitale Plattformen
In diesem letzten Abschnitt wird von der rechtlichen Analyse zur praktischen Anwendung übergegangen und es werden die wichtigsten strategischen Schlussfolgerungen aus dem Xyrality-Urteil für Unternehmen, die in der digitalen Wirtschaft tätig sind, und ihre Steuerberater herausgearbeitet.
Bestätigung der Rolle der Plattform als "Deemed Supplier": Die Hauptbedeutung des Urteils liegt in der rückwirkenden Klarstellung, dass der Grundsatz des "deemed supplier" für App-Stores schon vor Inkrafttreten der ausdrücklichen Regeln in Artikel 9a der Durchführungsverordnung im Jahr 2015 galt. Durch die Bestätigung, dass Plattformen, die die wichtigsten Transaktionsbestandteile (Branding, Zahlung, Bedingungen) kontrollieren, bereits unter Artikel 28 der Mehrwertsteuerrichtlinie fallen, bietet das Urteil entscheidende Rechtssicherheit für Steuerzeiträume vor 2015 und festigt den Ansatz "Inhalt vor Form" für alle derartigen Vereinbarungen.
Klarheit über den Ort der Lieferung in Kommissionsgeschäften: Die eindeutige Trennung der beiden fiktiven Lieferungen durch den Gerichtshof schafft entscheidende Klarheit für die Steuerplanung. Er bestätigt, dass die Lieferung eines Entwicklers an eine Plattform eine B2B-Dienstleistung ist, bei der sich die MwSt-Pflichten nach dem Standort der Plattform (gemäß Artikel 44) richten und nicht nach dem Standort des Entwicklers oder des Endkunden. Dies vereinfacht die Einhaltung der Mehrwertsteuerpflicht für Entwickler, die weltweit über zentralisierte Plattformen verkaufen.
Enge Auslegung der Haftung nach Artikel 203: Die Entscheidung, die Haftung nach Artikel 203 strikt auf Situationen zu beschränken, in denen ein echtes Risiko von Einnahmeverlusten durch den Vorsteuerabzug besteht, ist eine wichtige Feststellung. Sie bietet den Unternehmen einen gewissen Schutz vor der Haftung für fälschlicherweise auf Quittungen oder Bestätigungen an Endverbraucher ausgewiesene Mehrwertsteuer und verhindert unverhältnismäßige Strafen, wenn tatsächlich keine Steuereinnahmen gefährdet sind.
Insgesamt ist der Fall Xyrality ein bahnbrechender Präzedenzfall, der für die mehrwertsteuerliche Behandlung von Verkäufen über die globale Plattformökonomie wesentliche Klarheit und Vorhersehbarkeit schafft.
Quelle: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305025&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1253328

Ausgewählte Einblicke
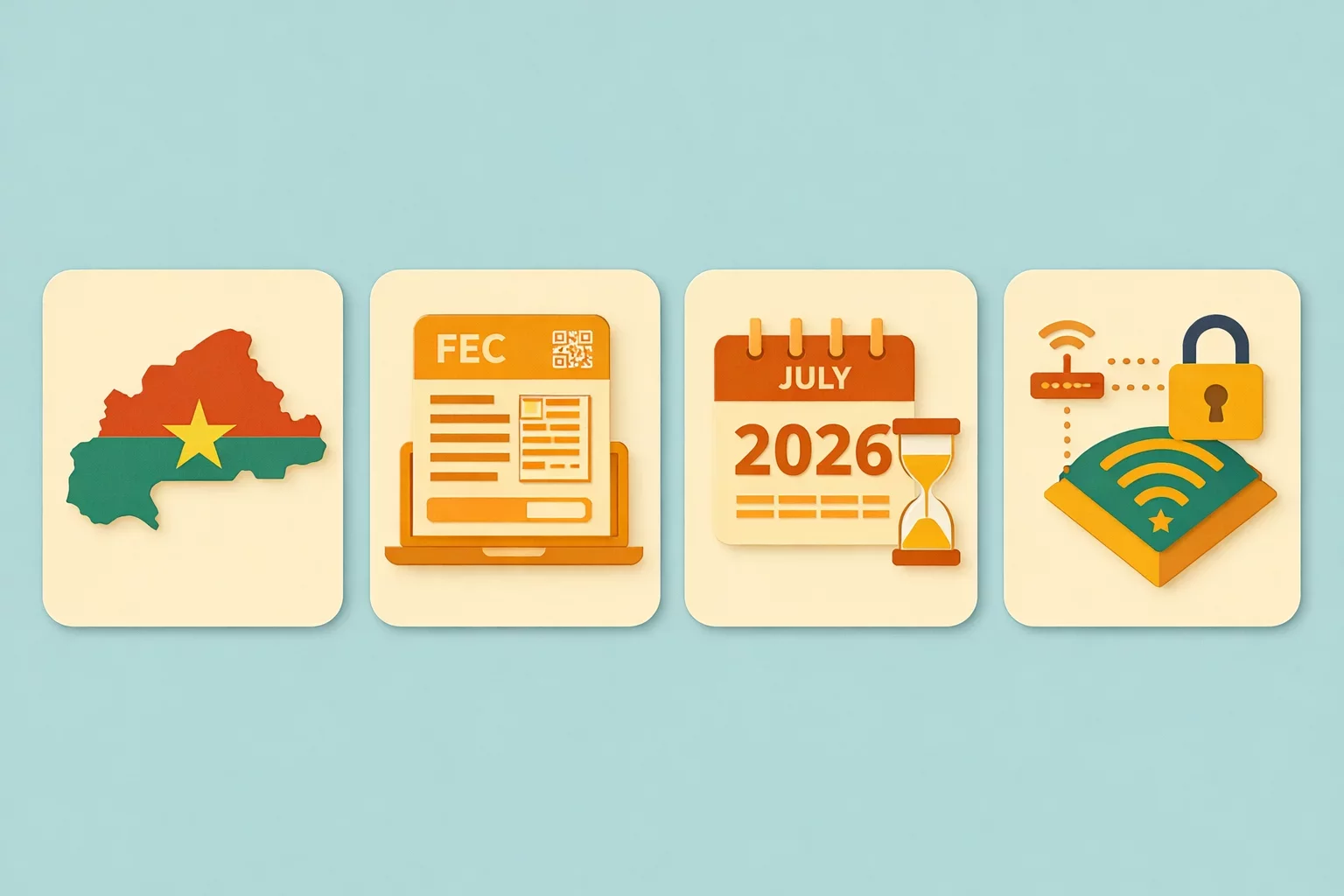
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Deutschland
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)

















