Recht auf Zinsen auf unrechtmäßige Einfuhr-, Ausfuhr- und Antidumpingzölle

Zusammenfassung
The Court of Justice of the European Union (Second Chamber) ruled that the EU law principles ensuring the right to repayment of wrongly levied sums and payment of corresponding interest apply broadly to various levies and penalties, including import duties, anti-dumping duties, late export refunds, and wrongful financial penalties. A person's right to interest arises whenever a national authority acts based on an incorrect interpretation or application of EU law — whether involving errors of law or fact — and this finding can be established by a national court. Furthermore, EU law strictly precludes national rules that limit the payment of compensatory interest only to the period following the initiation of legal proceedings, as compensation must cover the entire duration the funds were unavailable to the claimant.
3 Key Takeaways
• Expanded Scope of Financial Rights: The general principle requiring the recovery of sums paid but not due applies not only to traditional taxes or customs duties but also explicitly extends to financial penalties wrongly imposed and to export refunds that were wrongfully refused and paid late, ensuring the recipient receives interest compensation in all these situations.
• "Breach of EU Law" Defined Broadly: The condition for entitlement to interest — a breach of EU law — occurs whenever a national authority makes an incorrect interpretation or incorrect application of EU law, including errors of law or fact (such as misclassifying goods or misinterpreting refund requirements). This breach does not need to be established solely by the EU courts but can be found by a national court.
• Interest Must Cover the Full Period of Loss: The payment of interest must effectively compensate the person for the loss sustained due to the unavailability of the funds, which requires interest to accrue over the entire period from the date the money was wrongly paid/refused until the date of repayment/payment. Consequently, national legislation (such as German law) that restricts interest payments only to the period following the initiation of legal proceedings is incompatible with EU law.
🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
In den drei verbundenen Fällen geht es um Streitigkeiten zwischen deutschen Unternehmen und nationalen Zollbehörden über die Rückzahlung von Ausfuhrerstattungen, Antidumpingzöllen und Einfuhrzöllen. Außerdem geht es in diesen Fällen darum, ob für den Zeitraum, in dem die Beträge zu Unrecht einbehalten oder erhoben wurden, Zinsen fällig sind.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Zusammenlegung von Rechtssachen nicht üblich ist, bieten die Hintergründe der einzelnen Rechtssachen sowie die Schlussfolgerungen des Gerichtshofs und die Gründe für die Zusammenlegung der Rechtssachen einen einzigartigen Einblick in die Art und Weise, wie der Gerichtshof an die von ihm bearbeiteten Rechtssachen herangeht und wie er das EU-Recht auslegt.
Hintergrund der Rechtssachen
Da die Zusammenlegung von Rechtssachen eher die Ausnahme als die Regel ist, ist es für das Verständnis der Kernfragen erforderlich, die Hintergründe aller drei Rechtssachen zu untersuchen und ihren gemeinsamen Inhalt zu ermitteln, der zu der Entscheidung des EuGH führte, sie zu einer einzigen Rechtssache zusammenzulegen und ein einheitliches Urteil zu erlassen.
Fall 1: Rechtssache C-415/20 - Gräfendorfer gegen das Hamburger Zollamt
In der ersten Rechtssache geht es um Gräfendorfer, ein deutsches Unternehmen, das Geflügelschlachtkörper exportiert, und das Zollamt Hamburg, das den Antrag des Unternehmens auf Ausfuhrerstattungen für Sendungen zwischen Januar und Juni 2012 ablehnte. Der Hauptgrund für die Ablehnung des Erstattungsantrags und die Verhängung eines Bußgelds gegen das Unternehmen war die Behauptung des Zollamts, das Geflügel entspreche nicht dem Standard für handelsübliche Qualität gemäß den EU-Ausfuhrerstattungsvorschriften.
Da sich das Finanzgericht Hamburg jedoch auf ein früheres Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) stützte, der in einem anderen Verfahren entschieden hatte, dass das Vorhandensein einiger Federn und Innereien Geflügelschlachtkörper nicht von den Ausfuhrerstattungen ausschließt, änderte das Zollamt seine frühere Haltung, gewährte Gräfendorfer die Erstattungen und erstattete das Bußgeld.
Dennoch beantragte das Unternehmen 2015 Zinsen sowohl auf die erstatteten Beträge als auch auf das erstattete Bußgeld für die Zeit, in der ihm diese Beträge vorenthalten wurden, was das Zollamt ablehnte und den anschließenden Verwaltungsrechtsbehelf zurückwies.
Im Anschluss an diese Entscheidung erhob das Unternehmen 2018 Klage vor dem Finanzgericht Hamburg und machte geltend, dass das EU-Recht Einzelpersonen das Recht einräumt, nicht nur die Rückzahlung von Beträgen zu verlangen, die von nationalen Behörden unter Verstoß gegen das EU-Recht zu Unrecht einbehalten oder verhängt wurden, sondern auch Zinsen für den gesamten Zeitraum, in dem ihnen diese Beträge vorenthalten wurden. Das Finanzgericht stellte fest, dass weder das EU-Recht noch das deutsche Recht eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für einen solchen Zinsanspruch bieten, so dass die Frage anhand der in der EU-Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze geprüft werden musste.
Bei der weiteren Prüfung des Sachverhalts stellte das Finanzgericht fest, dass das EU-Recht einen Anspruch auf Zinsen als Entschädigung anerkennt, wenn Gebühren, Steuern, Abgaben oder Zölle unter Verstoß gegen das EU-Recht gezahlt werden, und fügte hinzu, dass es sich bei einem der streitigen Beträge nicht um eine Steuer oder Abgabe, sondern um eine Geldstrafe handelte. Diese Feststellung warf die Frage auf, ob die Rückzahlung einer solchen Strafe auch Zinsen umfassen sollte.
Da es keine EU-Rechtsprechung gibt und das deutsche Recht Zinsen nicht als allgemeinen Anspruch, sondern nur in eng umrissenen Situationen kennt, hielt es das Finanzgericht für erforderlich, den EuGH anzurufen, um zu klären, ob das EU-Recht in Fällen wie dem von Gräfendorfer Zinsen verlangt.
Fall 2: Rechtssache C-419/20 - Reyher gegen Zollamt Hamburg
Ähnlich wie im ersten Fall geht es auch im zweiten Fall um ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, Reyher, und das Hamburger Zollamt. In den Jahren 2010 und 2011 importierte das Unternehmen Verbindungselemente von einem indonesischen Lieferanten, der eine Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens war. Nach Prüfung der Zollpapiere stufte das Zollamt die Verbindungselemente als aus China stammend ein und wandte die in der EU-Verordnung Nr. 91/2009 festgelegten Antidumpingzölle an, so dass Reyher die entsprechenden Abgaben zahlen musste.
Obwohl das Unternehmen die verhängten Zölle zahlte, klagte es auch gegen diese Entscheidung vor dem Finanzgericht Hamburg. Das Finanzgericht entschied zu Gunsten des Unternehmens und stellte fest, dass das Zollamt nicht nachgewiesen hatte, dass die Waren ihren Ursprung in China hatten. Daher seien die Antidumpingzölle nicht rechtmäßig geschuldet. Infolgedessen erstattete das Zollamt Reyher im Mai 2019 die gezahlten Zölle, zahlte jedoch keine Zinsen auf den zurückgezahlten Betrag für den Zeitraum, in dem die Mittel nicht verfügbar waren.
Daraufhin erhob Reyher im Februar 2020 Klage vor dem Finanzgericht Hamburg und machte geltend, dass nach EU-Recht und Rechtsprechung jeder, der unrechtmäßig mit Antidumpingzöllen belastet wurde, nicht nur Anspruch auf Erstattung dieser Zölle, sondern auch auf Zinsen für den gesamten Zeitraum von der Zahlung bis zur Rückzahlung hat.
Das Finanzgericht legte das EU-Recht und das deutsche Recht aus und stellte fest, dass es keine anwendbaren Bestimmungen gibt, die Zinsen für den Zeitraum zwischen der Erhebung der Zölle und der Einleitung eines Gerichtsverfahrens vorsehen. Eine Frage blieb jedoch offen: Sind die nationalen Behörden nach EU-Recht verpflichtet, für den gesamten Zeitraum zwischen der rechtswidrigen Entrichtung von Antidumpingzöllen und ihrer etwaigen Rückzahlung Zinsen zu zahlen, auch wenn die nationalen Rechtsvorschriften einen solchen Anspruch auf einen kürzeren Zeitraum beschränken?
Fall 3: Rechtssache C-427/20 - Flexi gegen das Zollamt Kiel
Flexi, ein deutsches Unternehmen, das Bolzenhaken für die Herstellung von Hundeleinen einführt, ist ein weiteres Unternehmen, das in einen Streit über die richtige zolltarifliche Einreihung seiner Waren verwickelt ist. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Fällen war Flexi nicht mit dem Zollamt Kiel einverstanden, das die Einreihung der Bolzenhaken in eine andere Position der Kombinierten Nomenklatur als die von dem Unternehmen angemeldete für erforderlich hielt, was zu höheren Einfuhrzöllen führte.
Das Unternehmen leitete 2014 ein Gerichtsverfahren in dieser Angelegenheit ein, das 2017 zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs führte, das bestätigte, dass Flexi die Produkte korrekt eingereiht hatte. Außerdem hob das Gericht die Bescheide des Zolls auf. Dies bedeutete, dass das Zollamt die zu viel erhobenen Abgaben an das Unternehmen zurückzahlen musste. Wie in den beiden anderen Fällen weigerte sich das Zollamt, Zinsen auf den erstatteten Betrag für den Zeitraum zwischen der Zahlung der angefochtenen Abgaben und ihrer letztendlichen Rückzahlung zu gewähren.
Flexi leitete ein weiteres gerichtliches Verfahren ein, das dazu führte, dass das Zollamt Zinsen zahlte, allerdings nur für den Zeitraum von der Einleitung des Verfahrens durch das Unternehmen bis zur Rückzahlung. Die Frage, ob die Zinsen auch für den früheren Zeitraum, d. h. von der ersten Entrichtung der Abgaben bis zum Beginn des Rechtsstreits, zu zahlen sind, blieb jedoch ungeklärt.
Das mit dem Fall befasste Finanzgericht Hamburg bezweifelte, dass sich Flexi unmittelbar auf die Rechtsprechung des EuGH berufen kann, um solche Zinsen geltend zu machen, da es weder im EU-Sekundärrecht noch im deutschen nationalen Recht ausdrückliche Bestimmungen gibt.
Die wichtigsten Fragen aus dem Antrag auf Erlass einer Entscheidung
In der ersten Rechtssache legte das Finanzgericht Hamburg dem EuGH zwei Fragen vor. Mit der ersten Frage wollte es wissen, ob das EU-Recht die EU-Länder auch dann zur Rückzahlung von unter Verstoß gegen das EU-Recht erhobenen Abgaben mit Zinsen verpflichtet, wenn die Rückzahlung nicht dadurch ausgelöst wird, dass der Gerichtshof eine EU-Rechtsvorschrift für ungültig erklärt, sondern dadurch, dass der Gerichtshof einen Tarif der Kombinierten Nomenklatur anders auslegt als die nationalen Behörden ihn verwenden.
Bei der zweiten Frage ging es darum, ob die vom EuGH entwickelten Grundsätze für Zinsansprüche auch für Fälle gelten, in denen es um Ausfuhrerstattungen geht. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, ob Zinsen gezahlt werden müssen, wenn nationale Behörden solche Erstattungen unter Verstoß gegen das EU-Recht zu Unrecht verweigert und damit den Ausführern Mittel vorenthalten haben, auf die sie Anspruch hatten.
Die Fragen, die in der zweiten und dritten Rechtssache aufgeworfen wurden, waren ähnlich, jedoch mit spezifischen Unterschieden. Beide Fragen zielen auf eine Klärung der Frage ab, was einen Verstoß gegen das EU-Recht für die Geltendmachung von Zinsen darstellt.
In der zweiten Rechtssache wurde jedoch das Szenario angeführt, dass eine nationale Behörde eine Verpflichtung nach EU-Recht auferlegt. Im dritten Fall geht es darum, dass eine nationale Behörde eine Pflicht auferlegt, die unmittelbar gegen geltendes EU-Recht verstößt, und dass ein nationales Gericht diesen Verstoß bestätigt.
Anwendbarer EU-Richtlinienartikel
In diesen Fällen hat der EuGH keine Artikel und Bestimmungen der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie herangezogen. Stattdessen ging es um einschlägige Artikel und Bestimmungen des Zollkodex der Gemeinschaft, der mit der Verordnung Nr. 2913/92 des Rates eingeführt wurde, die später durch den Zollkodex der Union mit der Verordnung Nr. 952/2013 ersetzt wurde. In erster Linie die Artikel 236 Absatz 1, 241 und 116. Darüber hinaus legte der EuGH die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 800/1999 der Kommission aus, die später durch die Verordnung Nr. 612/2009 ersetzt wurde und in der die Durchführungsbestimmungen für diese Erstattungen festgelegt sind.
Nationale deutsche Vorschriften
In Bezug auf die deutschen Rechtsvorschriften legte der EuGH die wichtigsten Bestimmungen der deutschen Abgabenordnung aus, die alle Steuern, einschließlich der von den deutschen Behörden verwalteten EU- oder Bundessteuererstattungen, regelt und gleichzeitig die Einhaltung des EU-Rechts gewährleistet. Darüber hinaus wurde auch das deutsche Gesetz zur Umsetzung der gemeinsamen Marktorganisation und der Direktzahlungen sowie zur Regelung der Agrarbeihilfen, einschließlich der Ausfuhrerstattungen, geprüft und ausgelegt.
Bedeutung der Rechtssache für Steuerpflichtige
In Anbetracht der Komplexität der Einfuhr- und Ausfuhrverfahren und der Folgen, die sich für diejenigen ergeben können, die sich nicht an die Vorschriften und Verordnungen halten, sind diese Fälle für Steuerpflichtige, die am grenzüberschreitenden Handel beteiligt sind, von großer Bedeutung.
Da sich die Rechtssachen auf einige der wichtigsten Fragen in Bezug auf das Recht auf Rückzahlung von Beträgen, die von EU-Ländern zu Unrecht erhoben oder einbehalten wurden, einschließlich etwaiger Geldstrafen, Antidumpingzölle und einfuhr- oder ausfuhrbezogener Abgaben, konzentrieren, kann das Urteil erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen haben, die im Import oder Export tätig sind.
Analyse der Gerichtsentscheidungen
Der EuGH hat diese drei Rechtssachen erstmals im Jahr 2020 in der schriftlichen Phase des Verfahrens zusammengeführt. Später, im Jahr 2021, wurde die gleiche Entscheidung für die mündliche Verhandlung und das endgültige Urteil getroffen, was bedeutet, dass alle drei Fälle während des gesamten restlichen Gerichtsverfahrens zusammen behandelt werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich diese Fälle in mehreren Schlüsselbereichen überschneiden.
Eine der ersten Feststellungen des EuGH war, dass das EU-Recht jeder Person, die von einer nationalen Behörde unter Verstoß gegen das EU-Recht zur Zahlung einer Steuer, eines Zolls, einer Gebühr oder einer anderen Abgabe aufgefordert wurde, das Recht auf Rückzahlung dieses Betrags gibt. Darüber hinaus haben diese Personen Anspruch auf die Verzinsung des Betrags als Ausgleich für den Zeitraum, in dem das Geld nicht verfügbar war.
Ähnlich wie Steuern und Abgaben, die unter Verstoß gegen das EU-Recht gezahlt wurden, müssen auch Sanktionen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den EU-Vorschriften für landwirtschaftliche Ausfuhrerstattungen, zurückgezahlt werden. Der Betroffene hat Anspruch auf Zinsen als Entschädigung für den Zeitraum, in dem das Geld nicht zur Verfügung stand. Das Recht auf Zinsen gilt auch, wenn Ausfuhrerstattungen verspätet gewährt werden, nachdem sie zu Unrecht verweigert wurden, da die Verzögerung selbst auf einen Verstoß gegen das EU-Recht zurückzuführen ist, durch den dem Betroffenen vorübergehend die entsprechenden Mittel vorenthalten wurden.
Der EuGH betonte auch, dass der wichtigste Faktor, der dem Recht auf Rückzahlung und Zinsen nach EU-Recht zugrunde liegt, die Auferlegung einer Steuer, eines Zolls, einer Gebühr oder einer anderen Abgabe unter Verletzung des EU-Rechts ist. Der Verstoß kann jede EU-Vorschrift betreffen, und das Recht auf Rückzahlung und Zinsen ist ein allgemeiner Grundsatz, der nicht auf bestimmte Arten von Verstößen beschränkt ist. Der gleiche Grundsatz gilt auch, wenn nationale Rechtsvorschriften oder Maßnahmen einer nationalen Behörde EU-Recht falsch anwenden.
Allen drei Fällen ist gemeinsam, dass die nationalen Behörden bei der Auferlegung oder Verweigerung von Zahlungen wie Ausfuhrerstattungen, Geldstrafen, Antidumpingzöllen oder Einfuhrzöllen das EU-Recht falsch angewendet haben. Der EuGH fügte hinzu, dass Fehlinterpretationen, Rechtsfehler und faktische Irrtümer zur fehlerhaften Anwendung des EU-Rechts beigetragen haben.
Der Hauptzweck des Rechts auf Zinsen besteht darin, eine Person dafür zu entschädigen, dass ihr zu Unrecht Geld vorenthalten wurde. Während die Streitigkeiten über Zölle in den Rechtssachen Reyher und Flexi durch das EU-Zollrecht geregelt werden, das Vorschriften über die Erstattung enthält, betrifft der Streit über verspätete Ausfuhrerstattungen und eine zu Unrecht verhängte Geldstrafe in der Rechtssache Gräfendorfer EU-Vorschriften, die keinen ähnlichen Mechanismus zur Berechnung oder Zahlung von Zinsen enthalten.
Nach dem EU-Recht muss die Erstattung von zu Unrecht erhobenen Zöllen Zinsen enthalten. In beiden Fällen enthält das EU-Recht jedoch keine detaillierten Vorschriften für die Zinsberechnung. Die Festlegung dieser Regeln ist den einzelnen EU-Ländern überlassen, wobei sie verpflichtet sind, die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität zu beachten, d. h. sie dürfen die Geltendmachung der geschuldeten Zinsen nicht übermäßig erschweren oder unmöglich machen. Der EuGH stellte fest, dass dies auch für verspätete Zahlungen von Beträgen im Rahmen des EU-Rechts gilt, wie z. B. für die Ausfuhrerstattung in der Rechtssache Gräfendorfer.
Bei der Festlegung dieser Regeln müssen die EU-Länder sicherstellen, dass der Betroffene einen vollständigen Ersatz für den durch die unrechtmäßige Zahlung oder Verweigerung von Geldbeträgen entstandenen Schaden erhält. Darüber hinaus müssen die Zinsen für den gesamten Zeitraum zwischen der Zahlung oder dem Zeitpunkt, zu dem das Geld gezahlt wurde oder hätte gezahlt werden müssen, und der tatsächlichen Rückzahlung anfallen. Es ist mit dem EU-Recht unvereinbar, die Zinsen nur auf den Zeitraum nach der Klageerhebung zu beschränken und den früheren Zeitraum auszuschließen.
Obwohl das EU-Recht den nationalen Behörden nicht vorschreibt, Beträge automatisch zurückzuzahlen oder Zinsen zu zahlen, ohne dass der Betroffene dies veranlasst, müssen die EU-Länder bei der Festlegung von Regeln für die Zahlung von Zinsen auf zu Unrecht gezahlte oder vorenthaltene Beträge den Grundsatz der Wirksamkeit beachten. Dies bedeutet, dass es für den Einzelnen nicht übermäßig schwierig oder unmöglich sein darf, seine Rechte wahrzunehmen.
Es obliegt jedoch den nationalen Gerichten zu entscheiden, ob das nationale Recht diesen Grundsatz beachtet oder nicht. Der EuGH wies auch darauf hin, dass die nationalen Gerichte bei ihren Entscheidungen insbesondere Faktoren wie den Schutz der Verteidigungsrechte, die Rechtssicherheit, die ordnungsgemäße Durchführung von Verfahren und die Einhaltung des EU-Rechts abwägen sollten.
Endgültige Entscheidung des Gerichts
Nach der Zusammenführung aller drei Fälle und einer gründlichen Prüfung des Sachverhalts und der Begründetheit jedes einzelnen Falles entschied der EuGH, dass das EU-Recht das Recht des Einzelnen auf Rückzahlung von Beträgen, die von einem EU-Land zu Unrecht erhoben wurden, sowie auf Zinsen auf diese Beträge begründet. Das Gleiche gilt für Ausfuhrerstattungen, die verspätet gewährt werden, nachdem sie zu Unrecht verweigert wurden, sowie für Geldstrafen, die aufgrund solcher Verstöße verhängt werden.
Das Recht auf Rückzahlung umfasst auch Situationen, in denen nationale Behörden das EU-Recht falsch auslegen oder anwenden, wenn sie Zahlungen wie Ausfuhrerstattungen, Geldstrafen, Antidumpingzölle oder Einfuhrzölle auferlegen oder verweigern.
Schließlich kam der EuGH zu dem Schluss, dass die EU-Vorschriften und -Verordnungen nationale Rechtsvorschriften daran hindern, Zinsen auf den Zeitraum nach Einleitung eines Gerichtsverfahrens zu beschränken. Sie können jedoch ein solches Verfahren vorschreiben, solange die Ausübung der EU-Rechte dadurch nicht übermäßig erschwert wird.
Schlussfolgerung
Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Urteil ist, dass der EuGH den Grundsatz unterstrichen hat, wonach das EU-Recht das Recht auf Rückzahlung und Zinsen garantiert, wenn nationale Behörden gegen das EU-Recht verstoßen, unabhängig davon, ob es ausdrückliche Bestimmungen in den nationalen Rechtsvorschriften gibt.
Für Steuerpflichtige bekräftigt diese Entscheidung das Recht, eine vollständige Entschädigung oder zu Unrecht erhobene oder einbehaltene Beträge einzufordern, und stellt sicher, dass die EU-Länder die Verteidigungsrechte, die Rechtssicherheit, die ordnungsgemäße Durchführung von Verfahren und die Einhaltung des EU-Rechts beachten.
Quelle: Verbundene Rechtssachen C-415/20, C-419/20 und C-427/20, EU-Verordnung Nr. 91/2009, Kombinierte Nomenklatur, Verordnung Nr. 952/2013, Verordnung Nr. 612/2009

Ausgewählte Einblicke
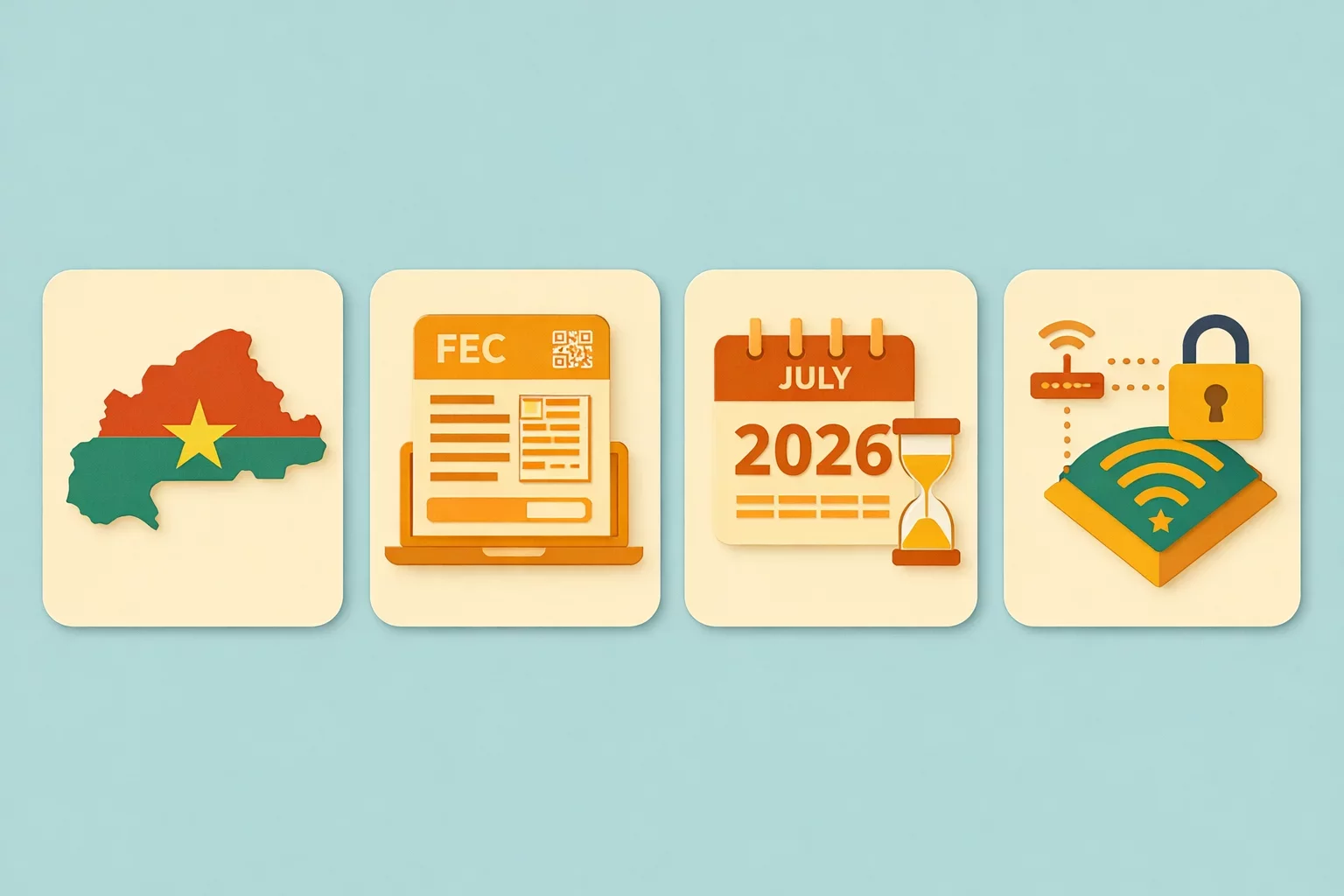
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Deutschland
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)

















