Recht auf Vorsteuerabzug beim Wiederaufbau von Anlagevermögen: Gerichtsurteil

Einführung: Recht auf Vorsteuerabzug beim Erwerb
Recht auf Vorsteuerabzug beim Erwerb: Wiederaufbau von Anlagevermögen
Obwohl im Folgenden ein konkretes Beispiel untersucht wird, können Unternehmen in ähnlichen Situationen den gleichen Ansatz auf ihre eigene Situation anwenden. Daher werden die Umstände des Falles hinreichend detailliert untersucht, um ein angemessenes Verständnis des Zusammenhangs bei der Auslegung der Funktionsweise des Vorsteuerabzugs bei der Rekonstruktion von Anlagegütern zu gewährleisten.
Hintergrund des Falles
So kam es in einem Fall des Obersten Verwaltungsgerichts zu einem Streit über die Entscheidung eines Steuerverwalters, einen Prüfbericht zu genehmigen, in dem der örtliche Steuerverwalter es ablehnte, das Recht des Klägers auf Vorsteuerabzug für (1) die Rekonstruktion von Anlagegütern, die von dem Unternehmen aus mehreren Objekten hergestellt wurden, und (2) für Dienstleistungen, die für die Vorbereitung eines technischen Projekts für die Rekonstruktion eines anderen Anlageguts erworben wurden, anzuerkennen, und darüber hinaus die Zahlung von Mehrwertsteuer und Steuerstrafen berechnete und anordnete und eine Mehrwertsteuerstrafe verhängte.
Der örtliche Steuerverwalter erließ diese Entscheidung im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Klägerin die bei der Rekonstruktion der Objekte geschaffenen Anlagegüter einem Dritten zur unentgeltlichen Nutzung überlassen habe und keine zum Vorsteuerabzug berechtigende wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt habe und nach den bei der Prüfung festgestellten Umständen auch nicht beabsichtige, eine solche auszuüben.
Standpunkt des Obersten Verwaltungsgerichts
Das Oberste Verwaltungsgericht Litauens stellte fest, dass die örtliche Steuerverwaltung der Klägerin das Recht auf den ursprünglichen Vorsteuerabzug verweigerte, d. h. sie stellt im Wesentlichen die ursprüngliche Absicht der Klägerin in Frage, die hergestellten Anlagegüter und die erworbenen Dienstleistungen (Vorbereitung eines technischen Umbauprojekts) für ihre steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeit zu verwenden. Mit anderen Worten, im vorliegenden Fall stellt die Steuerverwaltung nicht die Frage nach der Verpflichtung der Klägerin zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs in den in Artikel 66 Absatz 2 und Artikel 67 Absatz 5 des Mehrwertsteuergesetzes und in Artikel 185 der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Fällen (Gründen), sondern bestreitet das Vorliegen der Voraussetzungen für den ursprünglichen Vorsteuerabzug, als die Mehrwertsteuer auf den Erwerb abzugsfähig wurde.
Der Sachverhalt und die beurteilten Umstände werden im Folgenden näher beschrieben. Dies geschieht, um zu zeigen, welche Beweise im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer relevant sind, da dies die einzige Möglichkeit ist, die Mehrwertsteuervorschriften in der Praxis zu verstehen und anzuwenden.
Der Hauptstreitfall: Absicht der Verwendung für eine steuerpflichtige Tätigkeit
Darüber hinaus ist es nach Ansicht des Verfassers interessant und für das Praxisbeispiel relevant, dass das Oberste Verwaltungsgericht Litauens feststellte, dass sich der Streit im Wesentlichen darum drehte, ob die während der Steuerprüfung gesammelten und von der Klägerin vorgelegten objektiven Beweise bestätigen, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs für den Erwerb der streitigen Anlagegüter und Planungsleistungen die Absicht hatte, diese Güter und Dienstleistungen für ihre steuerpflichtigen Tätigkeiten zu verwenden.
Rechtliche Begründung und Verweis auf die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
Das Oberste Verwaltungsgericht Litauens hat in seinem Urteil über die Rekonstruktion von Anlagegütern festgestellt, dass sich der Streit im vorliegenden Fall im Wesentlichen darum drehte, ob die Klägerin bei der Herstellung (dem Erwerb) der fraglichen Anlagegüter beabsichtigte, diese zur Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen zu verwenden. Zu dieser Frage und im Zusammenhang mit dem Sachverhalt stellte er fest, dass, wie der Gerichtshof festgestellt hat, eine Person, die bereits die Eigenschaft eines Steuerpflichtigen hat, beim Erwerb von Anlagegütern, die ihrer Natur nach sowohl für steuerpflichtige als auch für nicht steuerpflichtige Tätigkeiten verwendet werden können, ohne ausdrücklich ihre Absicht zu erklären, diese Güter steuerpflichtigen Tätigkeiten zuzuordnen, ohne jedoch die Möglichkeit auszuschließen, dass es zu diesem Zweck verwendet wird, steht die anfängliche Verwendung dieses Gegenstands für nichtsteuerliche Tätigkeiten (nach Prüfung des gesamten Sachverhalts, die Sache des vorlegenden Gerichts ist) nicht dem Schluss entgegen, dass er die in Art. 168 der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Voraussetzung erfüllt, wonach der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt des Erwerbs des betreffenden Gegenstands als solcher handeln musste.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass u. a. aus der Beurteilung der Art der streitigen Gegenstände und der Tätigkeiten der Klägerin nicht geschlossen werden kann, dass die Klägerin im Allgemeinen nicht die Absicht hatte, die streitigen Gegenstände für eine steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeit zu verwenden. Im vorliegenden Fall wurde jedoch durch objektive Beweise nachgewiesen, dass die Klägerin nach den Bestimmungen der Vereinbarung nicht in der Lage war, die im Rahmen des Projekts hergestellten Anlagegüter sowohl während der Durchführung des Projekts als auch während eines Zeitraums von fünf Jahren für ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu nutzen. So wusste die Klägerin erstens zum Zeitpunkt der Durchführung des Projekts, dass sie das Eigentum dem Betreiber unentgeltlich zur Verwaltung (Nutzung) überlassen musste, d. h., dass die erste Nutzung der hergestellten Anlagegüter nicht mit der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin zusammenhängen würde. Zweitens ist bei der Beurteilung der Handlungen des Klägers und der objektiven Beweise für seine Absichten auch zu berücksichtigen, dass die fragliche Immobilie dem Betreiber unentgeltlich für einen Zeitraum von zehn Jahren übertragen wurde, d. h. für einen Zeitraum, der länger ist als die in der Vereinbarung vorgesehene Beschränkung (im Rahmen aller in der Rechtssache erörterten und festgestellten Umstände wird das Vorbringen des Klägers zu seiner Absicht, die streitige langfristige Immobilie nach Ablauf des in der Vereinbarung vorgesehenen Zeitraums der Beschränkung der Tätigkeiten für seine steuerpflichtige Tätigkeit zu nutzen, objektiv widerlegt).
Beweise gegen die Absicht des Klägers
Das Oberste Verwaltungsgericht Litauens stellt fest, dass diese Umstände bestätigen, dass der Antragsteller das streitige langfristige Eigentum (sowohl bewegliches als auch unbewegliches) mindestens zehn Jahre lang ab dem Zeitpunkt seiner Herstellung verwendet hat, d. h. wesentlich länger als der Zeitraum für die Berichtigung des streitigen Vorsteuerabzugs (Artikel 67 Absatz 2 des Mehrwertsteuergesetzes (in der Fassung des Gesetzes Nr. IX-751 vom 5. März 2002); Artikel 187 der Mehrwertsteuerrichtlinie), und zwar in erster Linie in der Absicht, es für andere als die in Artikel 58 Absatz 1 des Mehrwertsteuergesetzes genannten Tätigkeiten zu verwenden. In Anbetracht des Wesens und des Zwecks des Berichtigungszeitraums für die Mehrwertsteuer auf Gegenstände des Anlagevermögens und des Ziels der Mehrwertsteuerrichtlinie, das Recht auf Vorsteuerabzug eng und unmittelbar an die Verwendung der betreffenden Gegenstände oder Dienstleistungen für steuerpflichtige Umsätze zu knüpfen, legt das Gericht folgerichtig aus, dass unter den Umständen des vorliegenden Falles das Vorbringen der Klägerin zu den von ihr abgezogenen Mehrwertsteuerbeträgen für den streitigen Kauf nicht stichhaltig ist.
Vorsteuerabzug und Verwaltungsgebühr
Das Gericht geht daher konsequent davon aus, dass unter den Umständen des vorliegenden Falles das Vorbringen der Klägerin zu der an den Betreiber gezahlten festen Verwaltungsgebühr die fragliche Beurteilung nicht widerlegt. Der steuerpflichtige Wert von Dienstleistungen besteht nämlich in der gesamten Gegenleistung für die erbrachte Dienstleistung, so dass die Erbringung von Dienstleistungen nur dann steuerpflichtig ist, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der erbrachten Dienstleistung und der erhaltenen Gegenleistung besteht. Daraus folgt, dass eine "gegen Entgelt" erbrachte Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie nur dann steuerpflichtig ist, wenn zwischen dem Leistungserbringer und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, in dem eine gegenseitige Verpflichtung erfüllt wird, und die vom Leistungserbringer erhaltene Gegenleistung dem tatsächlichen Wert der für den Leistungsempfänger erbrachten Dienstleistung entspricht.
Wie lautet die Zusammenfassung?
Auf der Grundlage des untersuchten Falles des Obersten Verwaltungsgerichts und der eigenen Auslegung des Gerichts lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen:
1) Wie bereits erwähnt, verbot die Vereinbarung die Verwendung der strittigen langfristigen Vermögenswerte, die während der Durchführung des Projekts geschaffen (hergestellt) wurden, für wirtschaftliche Tätigkeiten;
2) Aus der Sicht der wirtschaftlichen Logik (Verhältnis zwischen dem Wert des auf den Betreiber zu übertragenden langfristigen Vermögens und der Höhe der Verwaltungsgebühr) kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Verwaltungsgebühr dem tatsächlichen Wert der Dienstleistung entspricht oder dass der Antragsteller beabsichtigte, das strittige langfristige Vermögen zehn Jahre lang für die Erbringung von Dienstleistungen mit einem steuerpflichtigen Wert in Höhe des durchschnittlichen monatlichen Bruttogehalts zu verwenden;
3) Zweck und Inhalt der fraglichen Verwaltungsgebühr implizieren auch, dass der Betreiber diese Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen und nicht für das erworbene Recht zur Nutzung des streitigen langfristigen Wirtschaftsguts zahlt.
Somit besteht für die Zwecke der Mehrwertsteuer kein direkter Zusammenhang zwischen der fraglichen Verwaltungsgebühr und der Dienstleistung, die in der Einräumung des Rechts auf Nutzung des streitigen langfristigen Vermögensgegenstands besteht; diese Gebühr kann u. a. angesichts ihrer Höhe und ihres Zwecks nicht als tatsächliches Entgelt für die letztgenannte Dienstleistung angesehen werden.
Im Übrigen weist das LVAT darauf hin, dass die Argumente der Rechtsmittelführerin diese Einschätzung in keiner Weise widerlegen - im vorliegenden Fall ist die Bewertung der Verwaltungsgebühr als Gegenleistung für das dem Betreiber eingeräumte Recht zur Nutzung der langfristigen Vermögenswerte widerlegt, und der Zusammenhang zwischen dieser Gebühr und den anderen Tätigkeiten der Klägerin ist nicht relevant.

Ausgewählte Einblicke
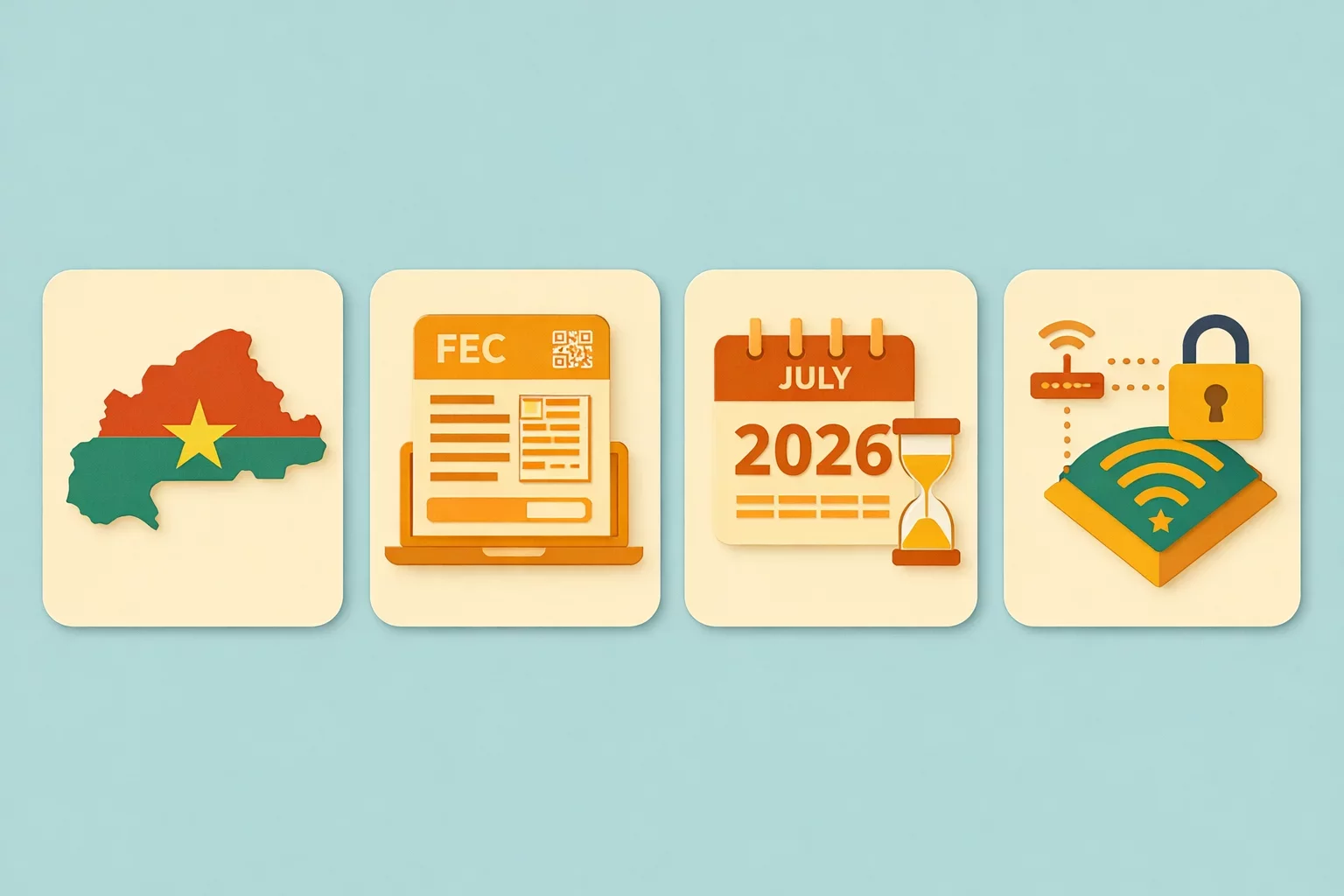
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Litauen
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)
















-fhtic1pwml.webp)








.png)