Italiens Mehrwertsteuerreform: Rechtliche Auswirkungen des Gesetzesdekrets Nr. 141/2024

🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
Am 4. Oktober 2024 trat das Gesetzesdekret Nr. 141/2024 in Kraft, mit dem die italienische Einfuhrumsatzsteuer geändert und in eine "Grenzsteuer" umgewandelt wurde. Das Gesetz enthält den Zollkodex der Union (UCC) und ersetzt den konsolidierten Text der Zollgesetze (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale, im Folgenden TULD genannt), der im Präsidialdekret Nr. 43/1973 festgelegt ist.
Diese Reform stellt einen historischen Wendepunkt im italienischen Zollrecht dar, da sie die TULD aufhebt, sie an den UCC anpasst, das Sanktionssystem überarbeitet und gleichzeitig das einheitliche EU-Zollverfahren einführt. Die Reform sieht auch eine neue Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Zollbehörde, der Steuerbehörde und anderen Kontrollbehörden vor. Das Ergebnis ist zweifellos ein kohärenterer und modernerer Rechtsrahmen, der sich an europäischen Standards orientiert, auch wenn er in seiner jetzigen Form, wie wir noch sehen werden, auf Kritik gestoßen ist.
Eine der wichtigsten Neuerungen besteht darin, dass Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 141/2024 die Einfuhrumsatzsteuer ausdrücklich zu den so genannten "Grenzabgaben" zählt, außer in Fällen der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr ohne Entrichtung der Mehrwertsteuer aufgrund des Verbrauchs in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Regelung 42) oder der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr ohne Entrichtung der Mehrwertsteuer, die einer anderen Hinterlegungsregelung als der eines Zolllagers unterliegt (Regelung 45). Darüber hinaus wird mit Artikel 67 des Präsidialerlasses Nr. 633/1972 ein neuer Absatz (2-Quart) eingeführt, der die Leistung einer Sicherheit in Höhe des ausgesetzten Mehrwertsteuerbetrags verlangt.
Wenn die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr keine Grenzabgabe darstellt
Trotz des allgemeinen Grundsatzes, die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr als Grenzzoll einzustufen, gibt es wichtige Ausnahmen. Gemäß den Zollregelungen 42 und 45 gilt die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr nicht als Grenzabgabe, weil die Waren für die Verbringung in einen anderen EU-Mitgliedstaat bestimmt sind, in dem die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gilt.
Genauer gesagt:
Die Regelung 42 gilt für die Einfuhr von Waren in einen EU-Mitgliedstaat zur unmittelbaren Verbringung in einen anderen EU-Mitgliedstaat. In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer nicht an der Grenze, sondern im Bestimmungsland erhoben. Diese Regelung erleichtert den Handel innerhalb der EU, indem sie den administrativen und finanziellen Aufwand für die Zahlung der Mehrwertsteuer im Voraus verringert. Um diese Regelung in Anspruch nehmen zu können, müssen jedoch bestimmte Dokumentations- und Nachverfolgungsverfahren eingehalten werden, einschließlich einer Erklärung, die die Verbringung ins Bestimmungsland innerhalb der in den geltenden Vorschriften festgelegten Fristen bestätigt.
Die Regelung 45 gilt für die Einfuhr von Waren, die für mehrwertsteuerlich registrierte Unternehmen in einem anderen EU-Mitgliedstaat bestimmt sind, ohne dass an der Grenze Mehrwertsteuer erhoben wird. Ähnlich wie die Regelung 42 wird sie oft als "Mehrwertsteuerlager"-Regelung bezeichnet. Auch hier wird die Mehrwertsteuer im endgültigen Bestimmungsland verbucht, was vergleichbare Vorteile in Bezug auf die Vereinfachung der Steuerverfahren und die Verringerung der finanziellen Verpflichtungen bietet. Die Importeure müssen sicherstellen, dass die Waren tatsächlich für mehrwertsteuerlich registrierte Unternehmen in einem anderen EU-Mitgliedstaat bestimmt sind und dass alle Belege korrekt und vollständig sind.
Dementsprechend hat die italienische Zoll- und Monopolbehörde in ihrem Rundschreiben Nr. 20/2024 klargestellt, dass die Mehrwertsteuer nur dann als "Grenzzoll" gilt, wenn die Waren vorschriftswidrig in den steuerrechtlich freien Verkehr in Italien überführt werden. Dies ist insbesondere bei der Regelung 42 der Fall, wenn es keinen Nachweis dafür gibt, dass die Waren in einem anderen EU-Mitgliedstaat in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt wurden, und auch nicht dafür, dass die Waren das italienische Hoheitsgebiet verlassen haben, und bei der Regelung 45, wenn die Waren nicht ordnungsgemäß in der Buchhaltung des Mehrwertsteuerlagers erfasst wurden.
Diese Ausnahmen bestätigen, dass die Einstufung der Mehrwertsteuer als "Grenzabgabe" an Bedingungen geknüpft ist. Sie führen auch zu anfänglichen Auslegungs- und Anwendungsunsicherheiten, insbesondere im Falle von Streitigkeiten mit den Zollbehörden, wie weiter unten erläutert wird.
Die Rechtsnatur der Einfuhrumsatzsteuer: Herausforderungen der italienischen Reform im Lichte des EU-Rechts
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat wichtige Hinweise zur Natur der Einfuhrumsatzsteuer und zu den Unterschieden zwischen ihr und den Zöllen gegeben. Besonders deutlich wurde dies in seinem Urteil in der Rechtssache U.I. (Représentant en douane indirect) (C-714/20), in der der EuGH klarstellte, dass die Mehrwertsteuer nicht als EU-Eigenmittel oder als Zoll behandelt werden kann, wenn sie nicht ausdrücklich im EU-Recht als solche ausgewiesen ist. Diese Auslegung stellt die jüngste Reform Italiens im Rahmen des Gesetzesdekrets Nr. 141/2024 in Frage, das die Einfuhrumsatzsteuer mit Zöllen gleichsetzt und auf beide ähnliche Erhebungs- und Sanktionsregeln anwendet.
Der EuGH befasste sich auch mit der Frage, ob indirekte Zollvertreter gemäß Artikel 201 der MwSt-Richtlinie für die Einfuhrumsatzsteuer mitverantwortlich gemacht werden können. Der EuGH entschied, dass eine solche Haftung nur möglich ist, wenn das nationale Recht sie ausdrücklich und eindeutig als haftende Parteien benennt. Italien reagierte daraufhin mit dem Erlass von Rechtsvorschriften, die formell sowohl den Einführer als auch den indirekten Vertreter zur Mithaftung verpflichten.
Dieser Ansatz birgt jedoch die Gefahr, gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit zu verstoßen, der sowohl im EU-Recht als auch im italienischen Recht ein zentraler Wert ist. Dieser Grundsatz verlangt, dass die Gesetze klar, vorhersehbar und transparent sind, damit die Wirtschaftsbeteiligten ihre Verpflichtungen verstehen. Indem die italienische Reform die Grenzen zwischen Zoll- und Mehrwertsteuerrecht verwischt, führt sie zu Unklarheiten, die zu widersprüchlichen Auslegungen durch verschiedene Steuerbehörden, zu mehr Rechtsstreitigkeiten und zu operativer Unsicherheit für die Unternehmen führen können.
Die Reform scheint sich auf zwei Dinge zu stützen: ein Urteil des italienischen Kassationsgerichts aus dem Jahr 2022, in dem die Einfuhrumsatzsteuer als Grenzzoll behandelt wurde, und die Anerkennung des EuGH, dass die EU-Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum haben, wenn es darum geht, wen sie als Mehrwertsteuerschuldner benennen. Die Verschmelzung der Zoll- und Mehrwertsteuerregelungen könnte jedoch das Vertrauen in das Rechtssystem untergraben.
In der Praxis führt die Reform zu einem neuen Befolgungsaufwand. Nach der Regelung 42 müssen Importeure nun den Nachweis erbringen, dass Waren in einen anderen EU-Mitgliedstaat verbracht wurden, oder sie riskieren den Verlust der finanziellen Sicherheiten. Zwar gibt es Ausnahmen für zertifizierte Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO), doch bleiben die Anforderungen streng. Darüber hinaus dehnt die Reform straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen auf den Bereich der Mehrwertsteuer aus. Sie führt eine potenzielle Haftung für indirekte Zollagenten ein und wirft verfahrenstechnische Bedenken hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Verfahrens auf, insbesondere wenn sich verschiedene Sanktionsregelungen überschneiden. Diese Änderungen erfordern von den Einführern besondere Aufmerksamkeit, um Strafen zu vermeiden und die zunehmende rechtliche Komplexität zu bewältigen.
Abschließende Überlegungen
Ist es also richtig, die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr als "Grenzzoll" zu betrachten?
Nach Ansicht des Verfassers ist dies nicht der Fall. Diese Schlussfolgerung wird durch die ständige Rechtsprechung des EuGH und ein kürzlich ergangenes Urteil des italienischen Kassationsgerichtshofs gestützt, wie in diesem Artikel erläutert wird.
Im Laufe der Zeit hat die Rechtsprechung klargestellt, dass die Einfuhrumsatzsteuer nicht mit den in Artikel 34 des TULD geregelten "Grenzabgaben" gleichgesetzt werden kann, wie dies bei den Zöllen der Fall ist. Umgekehrt wurde die Mehrwertsteuer stets als "interne Steuer" eingestuft, was durch mehrere Urteile des italienischen Obersten Gerichtshofs bestätigt wurde. Der Mechanismus der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr ist eng mit dem allgemeinen Mehrwertsteuersystem verbunden, da sie nicht direkt auf das eingeführte Produkt selbst erhoben wird, sondern unter den einheitlichen Steuerrahmen fällt, der sowohl für inländische Umsätze in den EU-Mitgliedstaaten als auch für Einfuhren gilt.
Auf europäischer Ebene haben sowohl die Einfuhrumsatzsteuer als auch die Zölle ihren Ursprung in der Einfuhr von Waren in die EU und ihrer anschließenden Überführung in den Wirtschaftskreislauf der EU-Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund ist der Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung zur Zahlung der Mehrwertsteuer auf Einfuhren entsteht, derselbe wie bei den Zöllen, auch wenn die beiden Abgabenarten in ihrer Art und Funktion unterschiedlich sind. In der jüngsten europäischen Rechtsprechung wurde bekräftigt, dass sich die Mehrwertsteuer auf Einfuhren und die Zölle trotz einiger gemeinsamer Merkmale in Bezug auf Zweck und Inhalt unterscheiden.
Artikel 71 Absatz 1 Nummer 2 der MwSt-Richtlinie bestätigt diese Beziehung noch weiter, indem er den EU-Mitgliedstaaten gestattet, den Steueranspruch bei der Einfuhr der Mehrwertsteuer an den der Zölle anzugleichen. Insbesondere kann die Pflicht zur Entrichtung der Mehrwertsteuer neben den Zöllen entstehen, wenn die illegale Handlung, die die Zölle ausgelöst hat, darauf hindeutet, dass die Waren in den EU-Markt gelangt sind und verbraucht wurden, wodurch ein Steuertatbestand für Mehrwertsteuerzwecke geschaffen wurde.
Die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr weist jedoch besondere Merkmale auf, die ihre Anwendung betreffen. Sie fällt zwar nicht unter die Zollverpflichtungen an sich, muss aber dennoch im Rahmen der Zollverfahren entrichtet werden. In der Praxis muss die Einfuhrumsatzsteuer bei der Abgabe der Zollanmeldung entrichtet werden. Fällt die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr mit der Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr zusammen oder kommt es zu Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung der Mehrwertsteuerlager bis zur Entnahme der Waren, ist die Zollbehörde für die Steuererhebung zuständig. Umgekehrt ist die Agentur für Einnahmen für die Eintreibung zuständig, wenn die nicht gezahlte Mehrwertsteuer auf einen falschen Abzug bei der Selbstfakturierung zurückzuführen ist.
Die mit der Gesetzesverordnung Nr. 141/2024 eingeführten Gesetzesänderungen stellen also eine bedeutende Veränderung für die Wirtschaftsbeteiligten und die Verwaltung der zollbezogenen Steuern dar. Die Debatte ist jedoch noch lange nicht zu Ende, insbesondere wenn das Verfassungsgericht über die mögliche Verfassungswidrigkeit von Artikel 34 des (ehemaligen) TULD entscheiden muss, der die Vereinbarkeit der Zolleinziehung mit den straffreien Delikten der Nichtabführung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr betrifft. Sollte dies der Fall sein, müsste die Reform möglicherweise neu überdacht werden.
Mit der Mehrwertsteuerreform wird eine eher theoretische als praktische Situation geschaffen, die jedoch für die Steuerpflichtigen günstig ist. Positiv sind auch die konsequenten Änderungen der Artikel 88 und 112 des TULD. Erstere erlauben ausdrücklich die Selbstanzeige, um strafrechtlich relevante Verstöße zu regularisieren.
Schließlich gibt es im Einklang mit der obigen Analyse Anzeichen dafür, dass eine Überarbeitung des Strafrahmens der Gesetzesverordnung Nr. 141/2024 bevorsteht. Insbesondere könnten neue Schwellenwerte eingeführt werden, um zwischen Zöllen, die bei 10.000 € bleiben könnten, und der Mehrwertsteuer, die auf 100.000 € angehoben werden könnte, zu unterscheiden.
-pcq6wpbnhf.webp)
Ausgewählte Einblicke
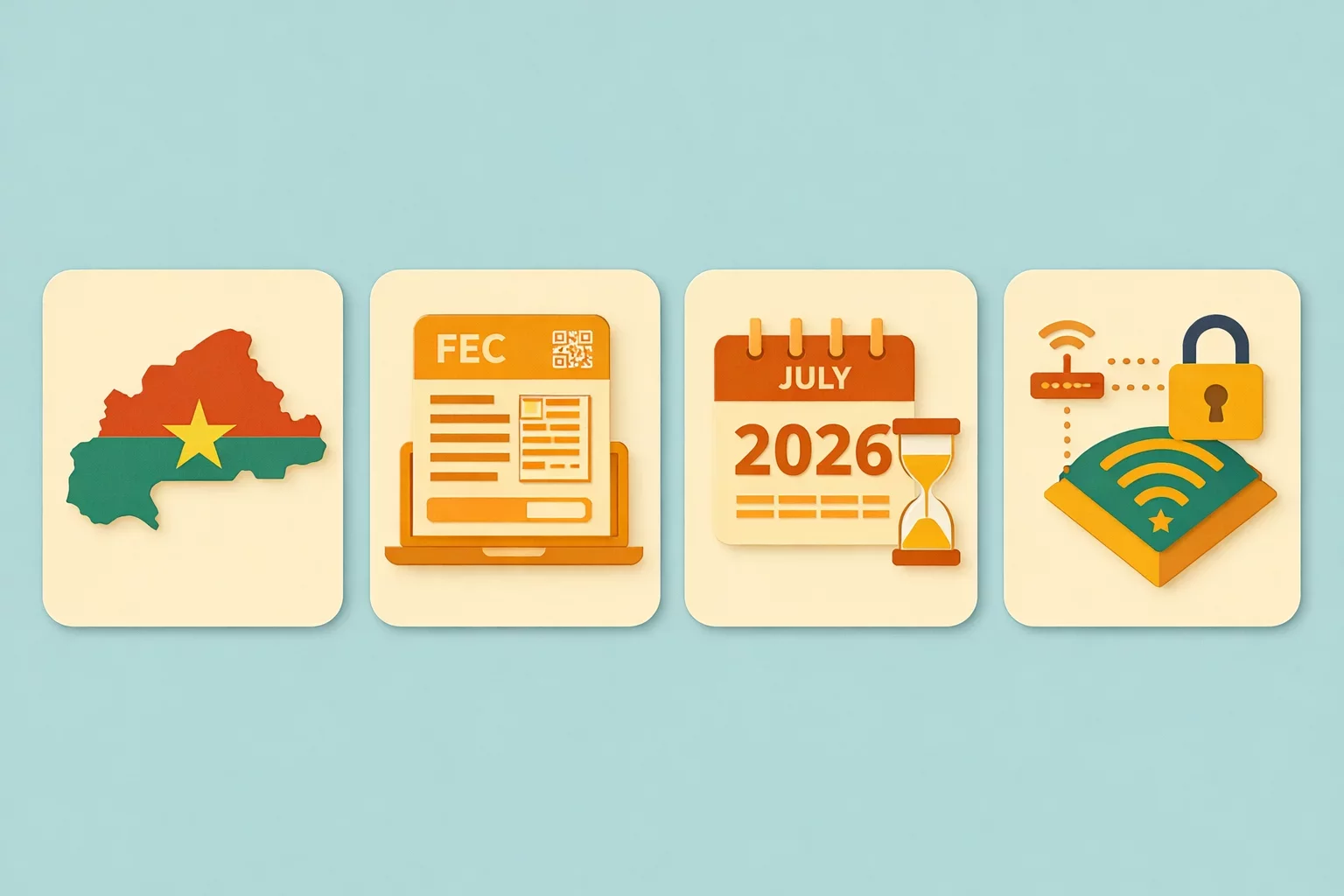
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Italien
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-hssrwb5osg.webp)
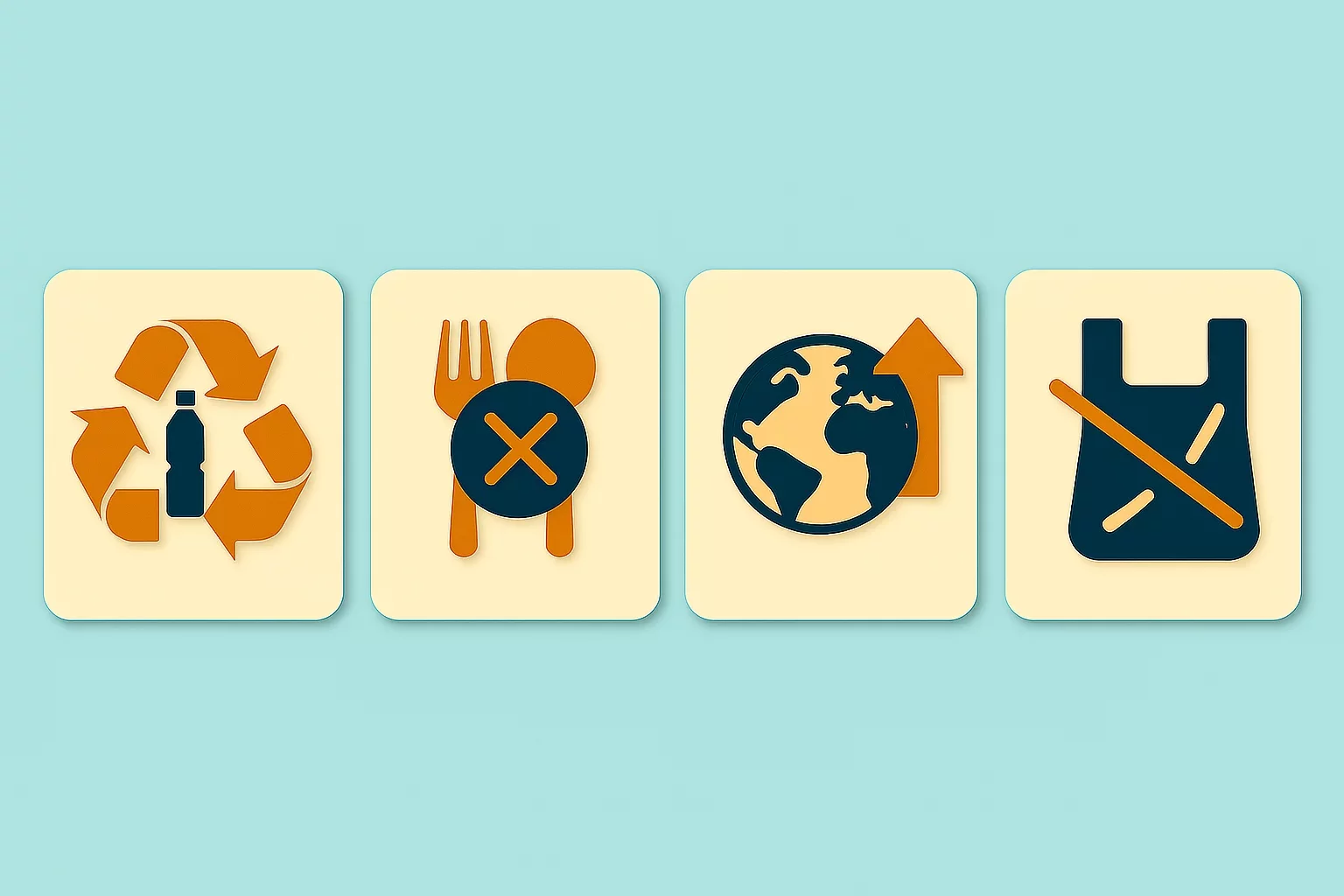

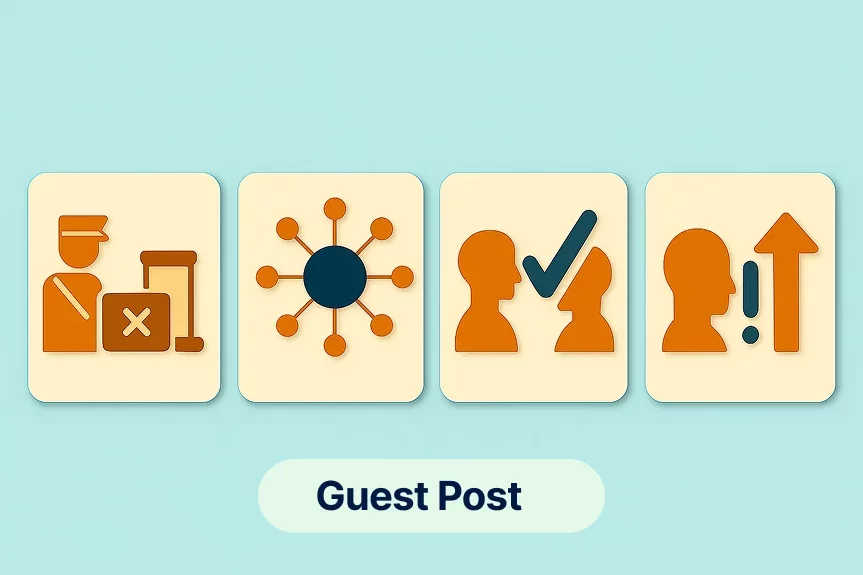
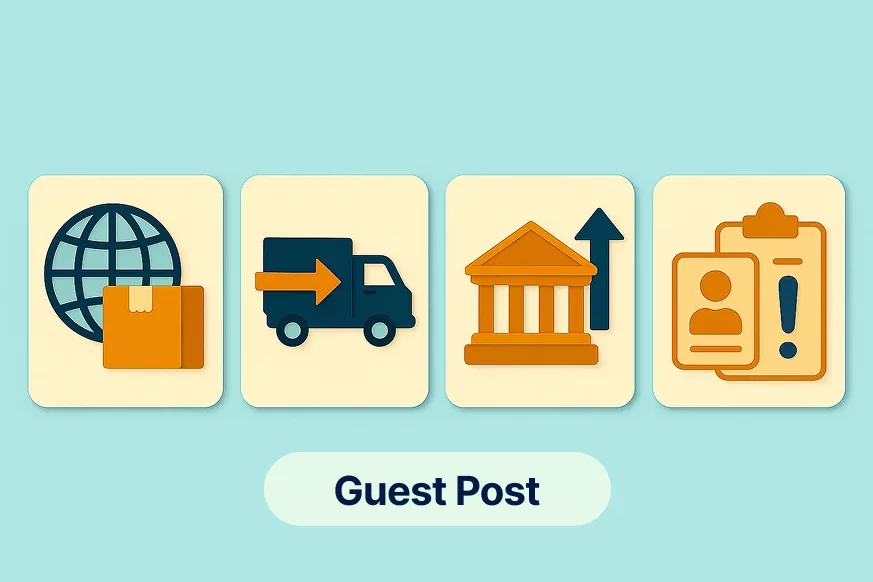
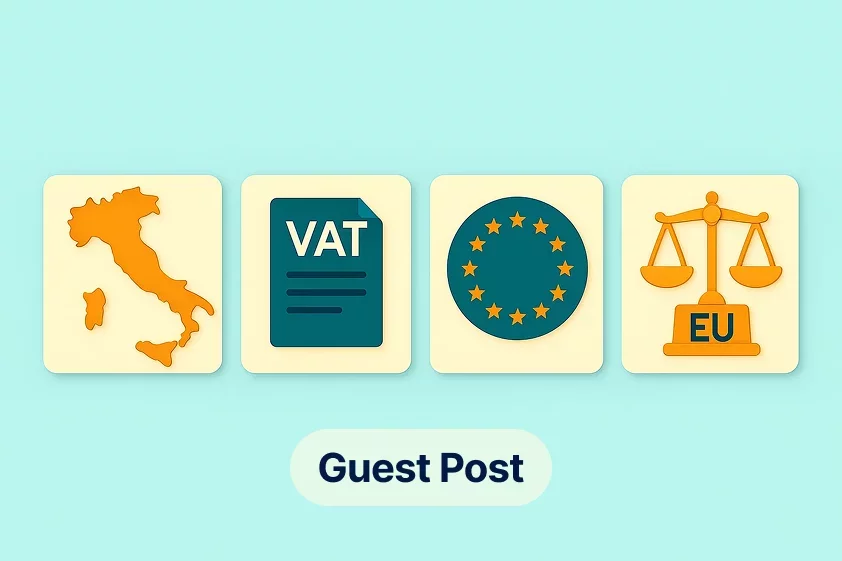
-7xsxxoypnx.webp)
-o7f4ogsy06.webp)
-9mc55kqwtx.webp)
-jrdryw2eil.webp)
-t9qr49xs2u.webp)

-zetvivc79v.png)
-qizq6w2v5z.png)

-k1j4au0ph6.webp)
-ig9tutqopw.webp)







