EuGH verschärft Regeln zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls: Keine weitergehenden Ablehnungsgründe - C-481/23

Am 10. April 2025 fällte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ein wichtiges Urteil in der Rechtssache C-481/23 (Sangas), in dem er klarstellte, wie eng die fakultativen Gründe für die Nichtvollstreckung in Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 6 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates (Europäischer Haftbefehl oder EAW-Rahmenbeschluss) anzuwenden sind. Der Fall entstand aus einem Streit zwischen Spanien und Rumänien über die Frage, ob Rumänien die Vollstreckung eines von Spanien ausgestellten Europäischen Haftbefehls zur Strafverfolgung eines spanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Rumänien unter Berufung auf verjährte Straftaten und einen langfristigen Aufenthalt verweigern kann.
Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der gesamten Europäischen Union. Sie bekräftigt den Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten die Gründe für die Ablehnung eines Europäischen Haftbefehls nicht über die im Rahmenbeschluss ausdrücklich vorgesehenen Gründe hinaus erweitern dürfen. Sie verdeutlicht auch, dass der Gerichtshof darauf besteht, die in den einschlägigen Bestimmungen festgelegten kumulativen Bedingungen einzuhalten, und schließt damit die Tür zu Versuchen, nationales Recht als Grundlage für weitergehende Ablehnungsbefugnisse zu nutzen.
Hintergrund und Sachverhalt
Im Mittelpunkt der Rechtssache stand ein spanischer Staatsangehöriger, im Urteil als JMTB bezeichnet, der sich seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig und ununterbrochen in Rumänien aufhielt. Im Februar 2022 wurde er von der Audiencia Nacional in erster Instanz als Mittäter dreier schwerer Steuerdelikte und eines Geldwäschedelikts verurteilt. Jedes der Steuerdelikte wurde mit einer zweijährigen Haftstrafe und einer hohen Geldstrafe geahndet: 23 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2011, 135 Millionen Euro für 2012 und 140 Millionen Euro für 2013. Das Geldwäschedelikt wurde mit einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und einer Geldstrafe von 54 Mio. EUR geahndet.
Die Straftaten standen im Zusammenhang mit einem ausgeklügelten Mehrwertsteuerbetrug, bei dem mehrere spanische Unternehmen gegründet und fiktive Geschäftsführer ernannt wurden. Ziel des Betrugs war es, die Zahlung von Mehrwertsteuer auf Verkäufe von Kohlenwasserstoffen in Spanien in den Geschäftsjahren 2011 bis 2013 zu vermeiden, wodurch dem spanischen Fiskus Verluste in Höhe von über 100 Mio. EUR entstanden.
Nach der Verurteilung legte der Angeklagte vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens Berufung ein, um eine Rechtsfrage zu klären. Da das Berufungsverfahren noch anhängig war, war die Verurteilung noch nicht rechtskräftig. In der Zwischenzeit hatte das spanische Gericht Präventivmaßnahmen verhängt, darunter ein Verbot, das spanische Hoheitsgebiet zu verlassen. Dennoch wurde JMTB später an der kroatischen Grenze auf dem Weg nach Rumänien abgefangen.
Am 6. April 2022 erließ die Audiencia Nacional eine nationale Entscheidung zur Festnahme und Inhaftierung von JMTB, zusammen mit einem internationalen Haftbefehl und einem Europäischen Haftbefehl. Mit dem Europäischen Haftbefehl sollte seine Anwesenheit für die Fortführung des Strafverfahrens in Spanien sichergestellt werden.
Die rumänischen Behörden weigerten sich jedoch, den Europäischen Haftbefehl zu vollstrecken. In einer Entscheidung der Curtea de Apel Alba Iulia (Berufungsgericht Alba Iulia) beriefen sie sich auf zwei fakultative Gründe für die Nichtvollstreckung nach rumänischem Recht: Erstens habe sich die Person seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Rumänien aufgehalten und sich gegen eine Übergabe ausgesprochen, und zweitens seien die Straftaten nach rumänischem Strafrecht verjährt, wobei die Verjährungsfrist für solche Straftaten zehn Jahre nach der letzten Straftat abläuft, was in diesem Fall spätestens am 31. Dezember 2013 gewesen wäre.
Rechtlicher Rahmen
Das mit dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI eingeführte System des Europäischen Haftbefehls beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses kann ein Europäischer Haftbefehl entweder zum Zwecke der Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung ausgestellt werden.
Im Rahmenbeschluss werden sowohl zwingende als auch fakultative Gründe für die Ablehnung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls aufgeführt. In Artikel 3 sind die zwingenden Gründe aufgeführt, während Artikel 4 fakultative Gründe enthält, darunter:
- Artikel 4 Absatz 4, wonach die Vollstreckung abgelehnt werden kann, wenn die Strafverfolgung oder die Bestrafung nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats verjährt ist und die Handlungen nach seinem eigenen Strafrecht in seine Zuständigkeit fallen.
- Artikel 4 Absatz 6, der eine Ablehnung zulässt, wenn der Europäische Haftbefehl zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung ausgestellt wurde, wenn sich die gesuchte Person im Vollstreckungsmitgliedstaat aufhält oder dessen Staatsangehöriger ist oder dort ihren Wohnsitz hat und dieser Staat sich verpflichtet, die Strafe oder die Maßregel der Sicherung selbst zu vollstrecken.
Das rumänische Recht setzt diese Bestimmungen durch das Gesetz Nr. 302/2004 über die internationale justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen um. Nach Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe c dieses Gesetzes ist eine Ablehnung zulässig, wenn die gesuchte Person rumänischer Staatsbürger ist oder seit mindestens fünf Jahren in Rumänien wohnt, sich gegen eine Übergabe ausgesprochen hat und der Europäische Haftbefehl der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe dient. Nach Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe g ist eine Ablehnung möglich, wenn die Straftat nach rumänischem Recht verjährt ist und in die Zuständigkeit der rumänischen Behörden fällt.
Standpunkte der Parteien
Die spanischen Behörden machten geltend, dass die rumänische Ablehnung nach dem Rahmenbeschluss rechtswidrig sei. Ihrer Ansicht nach sei Artikel 4 Absatz 6 nicht anwendbar, da der Europäische Haftbefehl zum Zwecke der Strafverfolgung und nicht zur Vollstreckung einer Strafe ausgestellt worden sei. Außerdem könne man sich nicht auf Artikel 4 Absatz 4 berufen, da die Straftaten vollständig unter die spanische Gerichtsbarkeit fielen. Sie verwiesen auf die frühere Rechtsprechung des Gerichtshofs, insbesondere in der Rechtssache Puig Gordi u. a. (C-158/21), in der festgestellt wurde, dass die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen Gründe für die Nichtvollstreckung einführen können, die über die im Rahmenbeschluss genannten hinausgehen.
Das rumänische Gericht vertrat die Auffassung, dass die Verweigerung der Vollstreckung im Einklang mit dem rumänischen Recht stehe, und verwies auf den langfristigen Aufenthalt des Betreffenden und seine Ablehnung der Übergabe sowie auf die Tatsache, dass die Verjährungsfrist nach rumänischem Recht abgelaufen war.
Sowohl die Europäische Kommission als auch die spanische Regierung schlossen sich der Auslegung Spaniens an und betonten, dass die fakultativen Gründe nach Artikel 4 Absätze 4 und 6 strikt und kumulativ ohne nationale Erweiterungen anzuwenden seien.
Die Vorlagefragen
In Anbetracht dieses Konflikts setzte die Audiencia Nacional das Verfahren aus und legte dem EuGH zwei Fragen zur Vorabentscheidung vor:
1) Kann Artikel 4 Absatz 6 des Rahmenbeschlusses angewandt werden, wenn der Europäische Haftbefehl zur Strafverfolgung und nicht zur Vollstreckung einer Strafe erlassen wird, und kann er angewandt werden, ohne dass sich der Vollstreckungsstaat verpflichtet, die Strafe im Inland zu vollstrecken?
Kann Artikel 4 Absatz 4 angewandt werden, wenn die fraglichen Handlungen nicht in die Zuständigkeit des Vollstreckungsmitgliedstaats fallen, selbst wenn sie nach dessen nationalem Recht verjährt wären?
Die Analyse des Gerichtshofs
Zur ersten Frage betont der Gerichtshof, dass Artikel 4 Absatz 6 ausdrücklich auf Fälle beschränkt ist, in denen der Europäische Haftbefehl "zum Zwecke der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung" ausgestellt wird. Diese Bedingung ist keine bloße Formalität, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Anwendungsbereichs der Bestimmung. Die Logik von Artikel 4 Absatz 6 besteht darin, dass die Übergabe im Interesse der sozialen Wiedereingliederung der verurteilten Person abgelehnt werden kann, wenn der Vollstreckungsstaat bereit ist, die Strafe selbst zu vollstrecken. Diese Überlegung gilt nicht, wenn der Europäische Haftbefehl zur Strafverfolgung erlassen wird, da noch kein rechtskräftiges Urteil zur Vollstreckung vorliegt.
Im vorliegenden Fall wurde der Europäische Haftbefehl eindeutig zur Strafverfolgung ausgestellt. Zwar gab es eine erstinstanzliche Verurteilung, doch war diese in der Berufung und nach spanischem Recht nicht vollstreckbar. Die Entscheidung vom 6. April 2022 zielte darauf ab, die Anwesenheit des Angeklagten bei der Gerichtsverhandlung sicherzustellen, und nicht auf die Vollstreckung eines Urteils. Außerdem hatte sich Rumänien nicht verpflichtet, eine eventuelle Strafe im Inland zu vollstrecken. Die kumulativen Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 6 waren daher nicht erfüllt, und der Gerichtshof stellte fest, dass diese Bestimmung die Ablehnung nicht rechtfertigen konnte.
In Bezug auf die zweite Frage prüfte der Gerichtshof Artikel 4 Absatz 4, der die Ablehnung erlaubt, wenn die Verfolgung oder Bestrafung verjährt ist "und" die Handlungen in die Zuständigkeit des Vollstreckungsmitgliedstaats fallen. Der Gerichtshof betonte den kumulativen Charakter dieser Bedingungen: beide müssen erfüllt sein, damit der Grund anwendbar ist. Fallen die Handlungen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Vollstreckungsstaats, ist der Grund nicht anwendbar, selbst wenn die Straftat nach nationalem Recht als verjährt gelten würde.
Im vorliegenden Fall wurden die Straftaten ausschließlich in Spanien begangen, betrafen spanische Unternehmen und betrafen das spanische Mehrwertsteuersystem. Rumänien war für diese Handlungen nicht zuständig. Die zweite Voraussetzung von Artikel 4 Absatz 4 war daher nicht erfüllt, so dass es unerheblich war, ob die rumänischen Verjährungsfristen abgelaufen waren.
Die Antwort des EuGH war unmissverständlich:
- Art. 4 Abs. 6 erlaubt es nicht, einen zur Strafverfolgung ausgestellten Europäischen Haftbefehl abzulehnen, selbst wenn die Person im Vollstreckungsstaat wohnt, und kann nicht angewandt werden, ohne dass sich dieser Staat zur Vollstreckung der Strafe verpflichtet.
- Nach Artikel 4 Absatz 4 ist eine Versagung nicht zulässig, wenn die Handlungen nicht in die Zuständigkeit des Vollstreckungsstaats fallen, unabhängig davon, ob sie nach dessen innerstaatlichem Recht verjährt wären.
Auswirkungen für die Praxis
Dieses Urteil bekräftigt die strenge Auslegung der fakultativen Gründe für die Ablehnung der Vollstreckung im EAW-Rahmenbeschluss. Für Praktiker bedeutet dies, dass es keinen Spielraum gibt, sich in Fällen der Strafverfolgung auf Artikel 4 Absatz 6 zu berufen oder Artikel 4 Absatz 4 bei fehlender Zuständigkeit anzuwenden, selbst wenn das innerstaatliche Recht eine solche Ablehnung unterstützen könnte.
Die Entscheidung steht im Einklang mit dem umfassenderen Ansatz des Gerichtshofs in der Rechtssache Puig Gordi u. a., der nationalen Gesetzen, die zusätzliche Gründe für die Ablehnung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls vorsehen, die Tür verschließt. Sie sendet auch eine klare Botschaft an Strafverteidiger und Staatsanwälte gleichermaßen: In grenzüberschreitenden Betrugs-, Mehrwertsteuerhinterziehungs- und ähnlichen Fällen ist der Spielraum für die Ablehnung der Übergabe aufgrund des Wohnsitzes oder von Verjährungsfristen äußerst eng.
Für die Mitgliedstaaten unterstreicht das Urteil, wie wichtig es ist, die nationalen Umsetzungsvorschriften mit dem genauen Wortlaut des Rahmenbeschlusses in Einklang zu bringen. Bei Abweichungen oder Erweiterungen auf nationaler Ebene besteht die Gefahr, dass sie am EU-Recht scheitern.
Schlussfolgerung
DieRechtssache C-481/23 (Sangas) erinnert daran, dass das System des Europäischen Haftbefehls auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Anerkennung beruht, mit nur begrenzten und klar definierten Ausnahmen. Das Beharren des EuGH auf einer wörtlichen und kumulativen Auslegung von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 6 bedeutet, dass die Mitgliedstaaten Aufenthalts- oder Verjährungsfristen nicht als Hintertür nutzen können, um die Übergabe zu verweigern, wenn nicht alle im Rahmenbeschluss genannten Bedingungen erfüllt sind.
Indem der Gerichtshof die Berufung Rumäniens auf sein eigenes Recht zur Ausweitung der Ablehnungsbefugnisse zurückgewiesen hat, hat er die einheitliche Anwendung der EHB-Regelung bekräftigt. In grenzüberschreitenden Fällen von Mehrwertsteuer- und Finanzkriminalität stärkt dies die Fähigkeit der ausstellenden Staaten, die Rückführung von Verdächtigen und Beschuldigten sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die verfahrensrechtliche und materielle Justiz dort verfolgt werden kann, wo die Straftaten begangen wurden.
CJEU - C-481/23 - ECLI:EU:C:2025:259 - Rumänische Ablehnung des Haftbefehls verstößt gegen EU-Recht >>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0481
Ausgewählte Einblicke
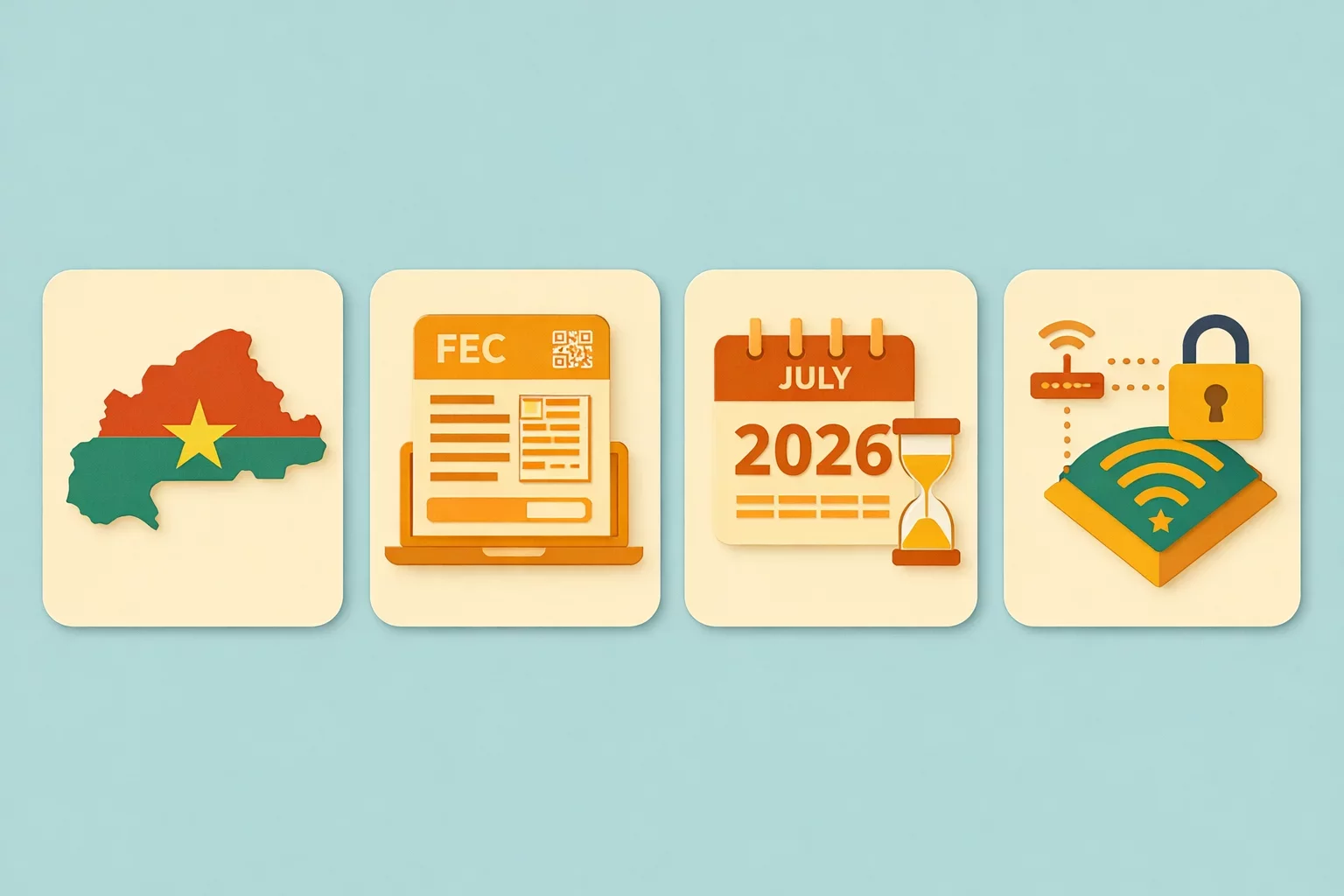
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
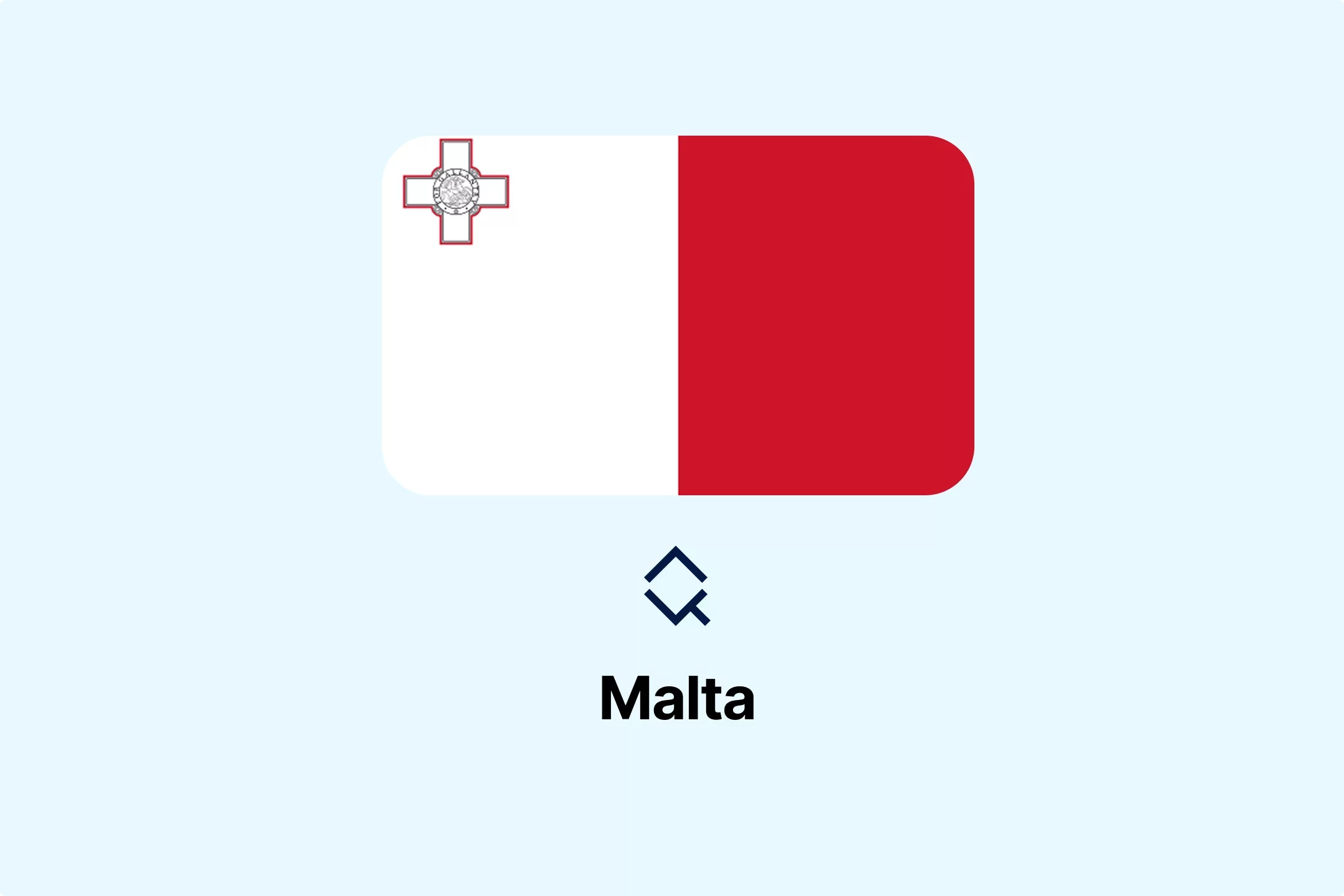
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
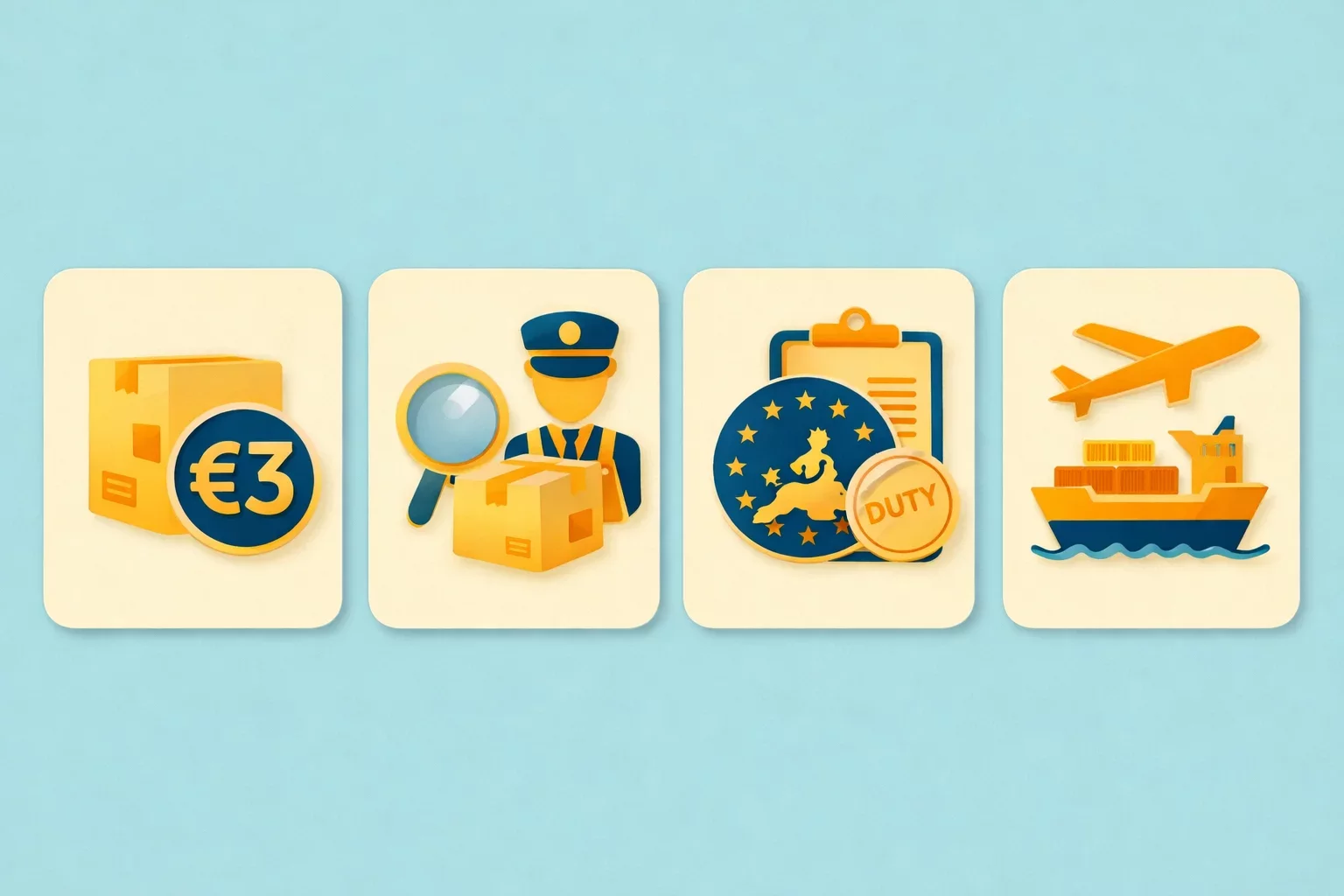


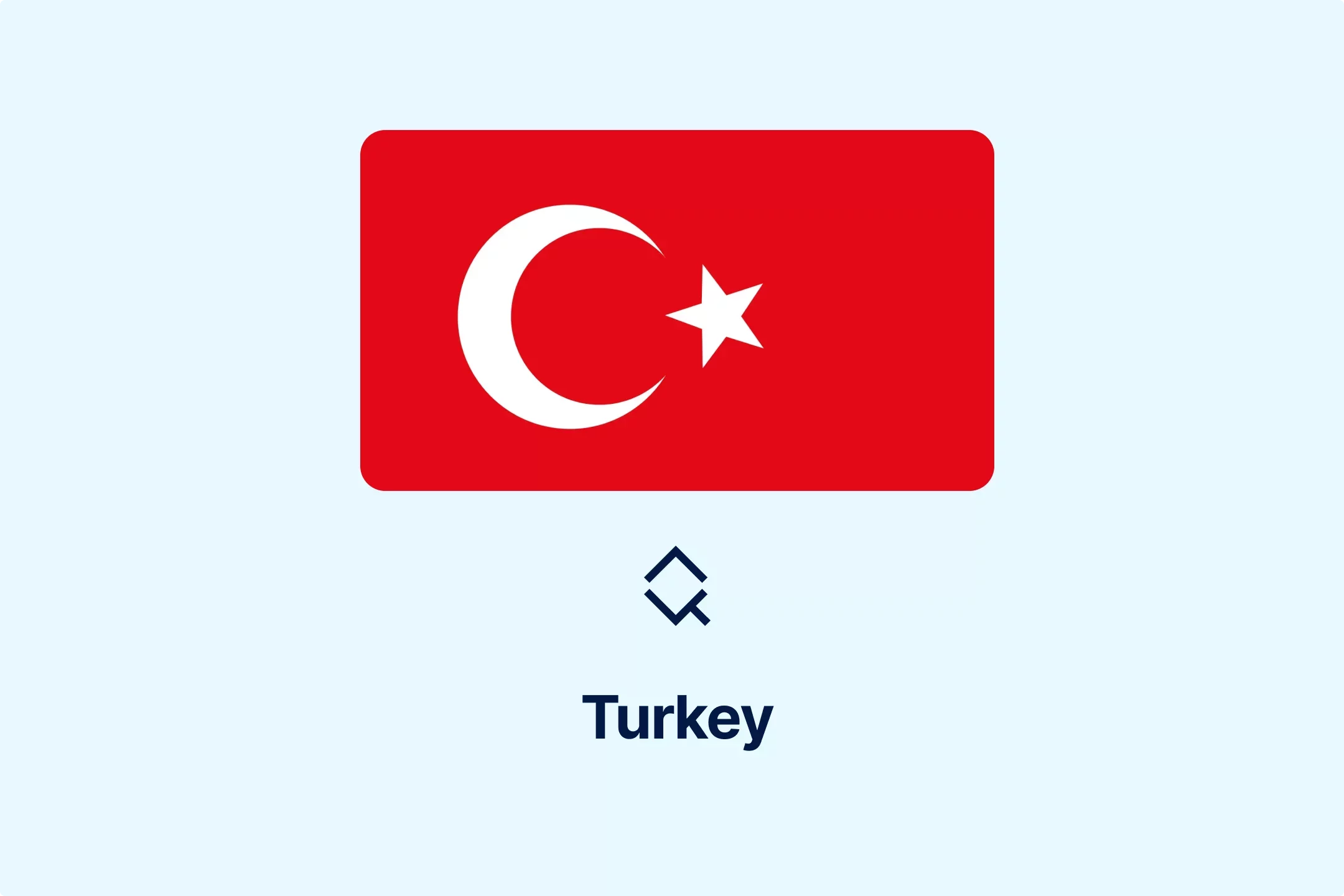




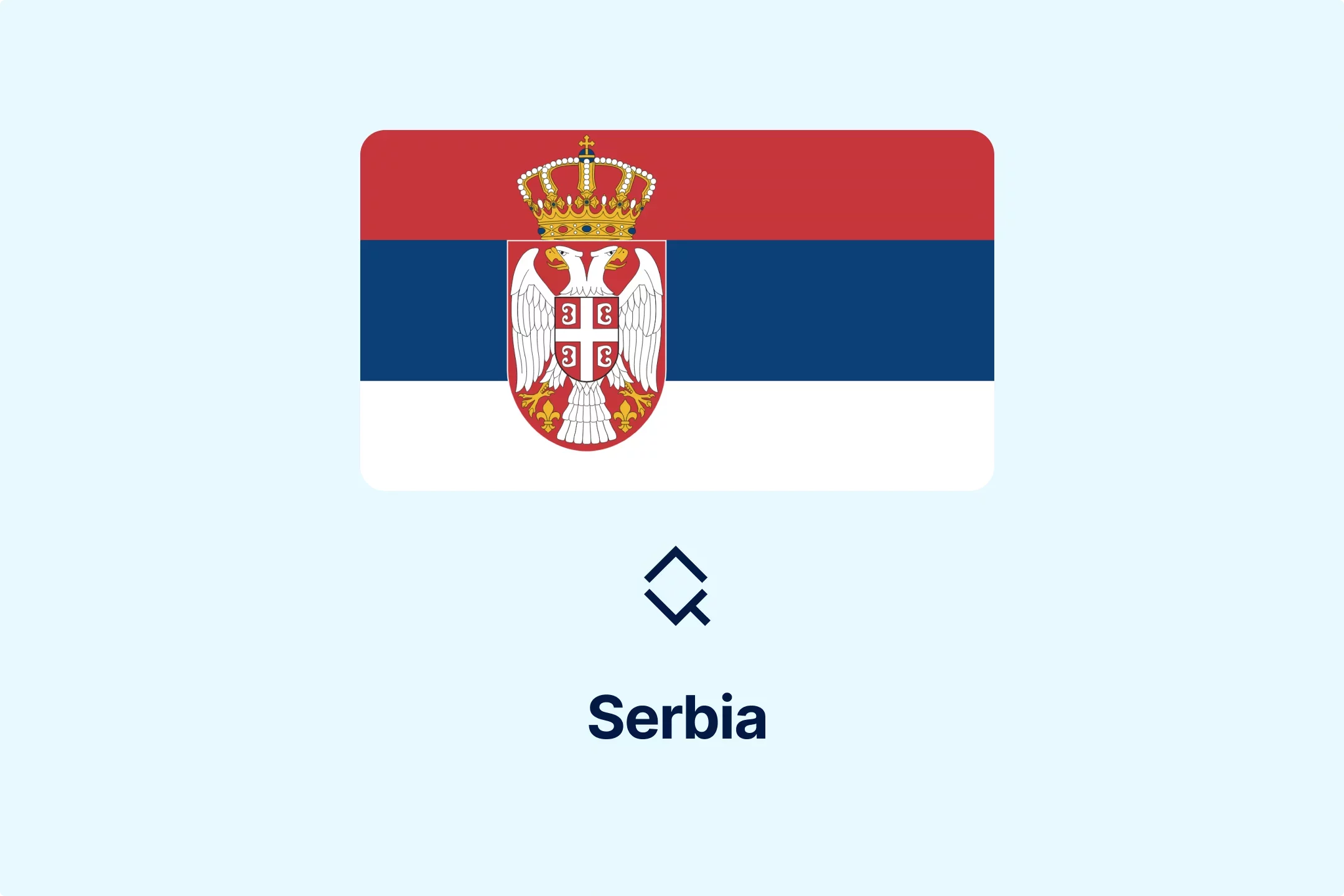
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



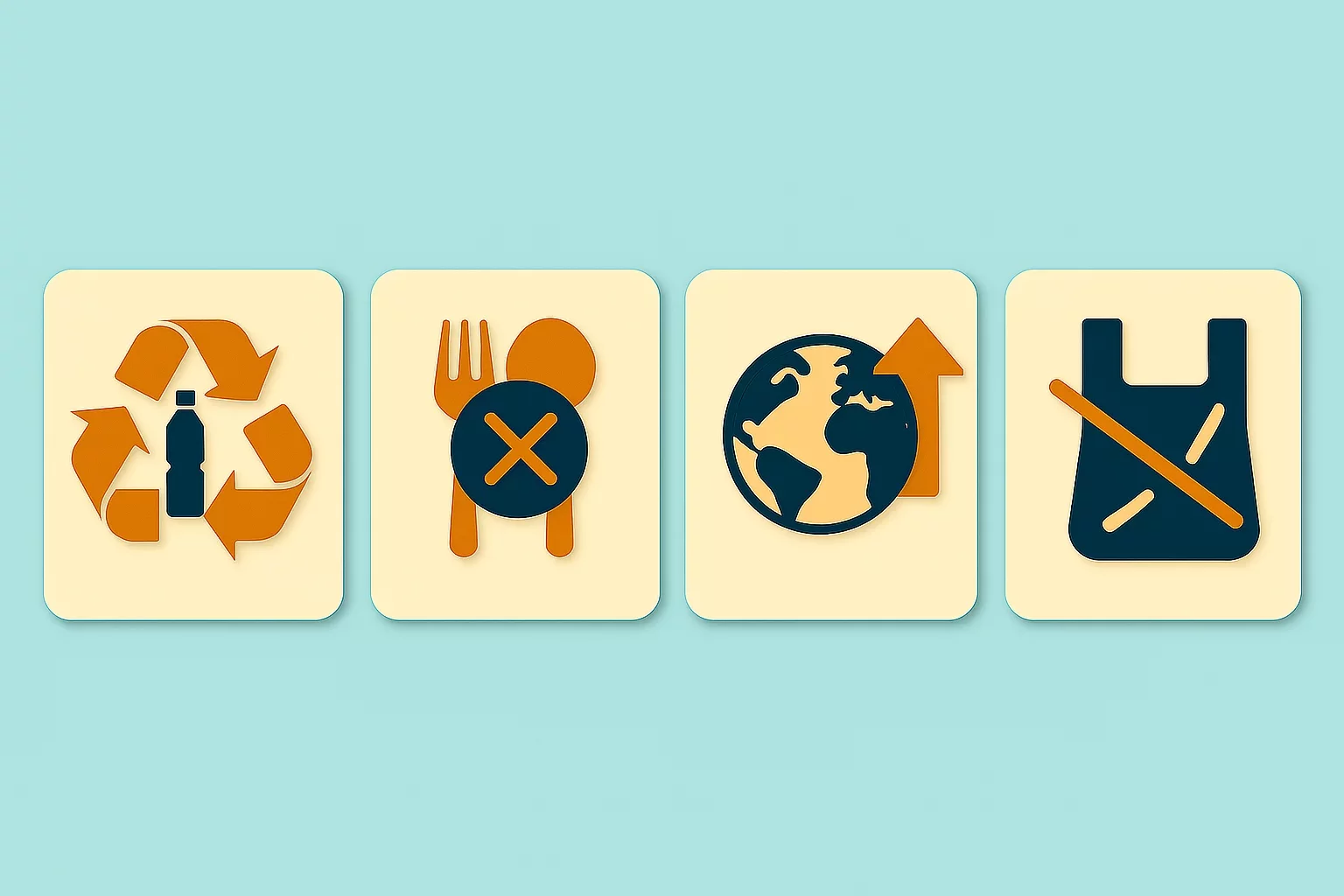


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
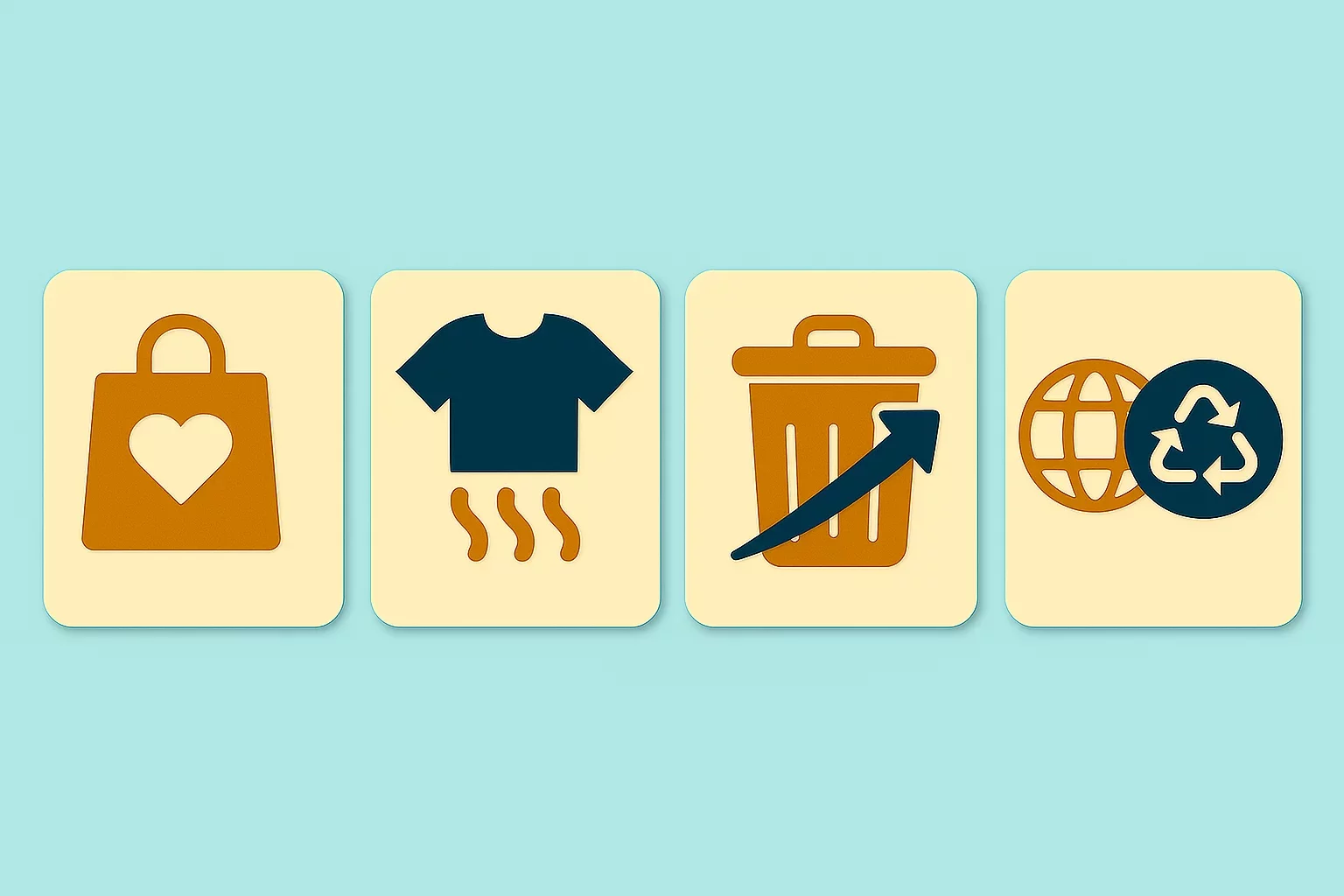

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
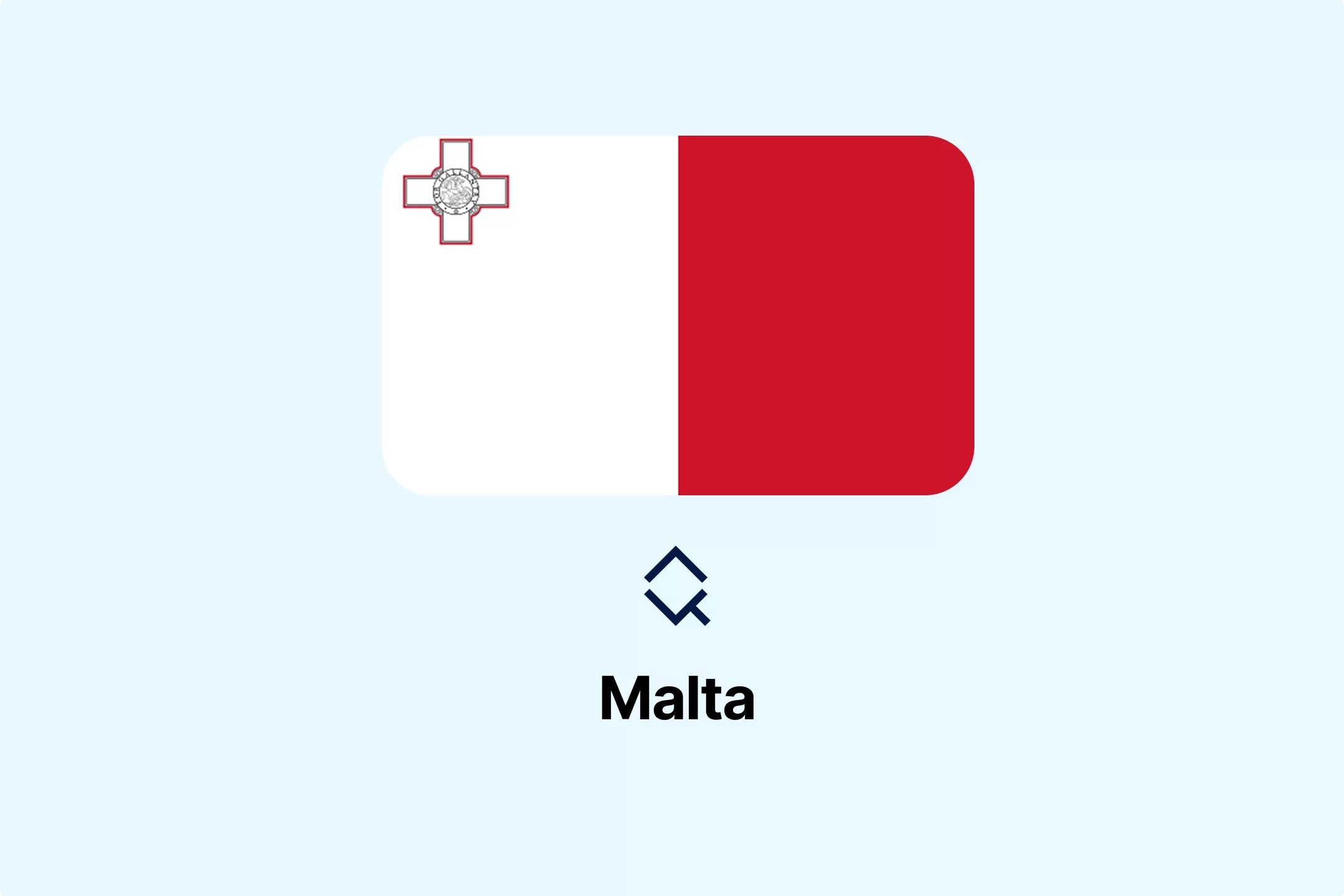
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
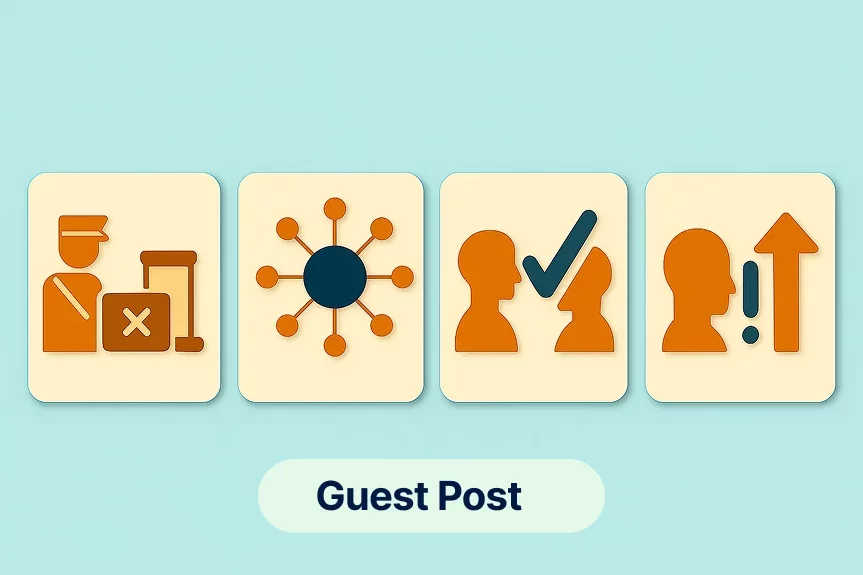

-hafis0ii23.webp)

-qseaw5zmcy.webp)


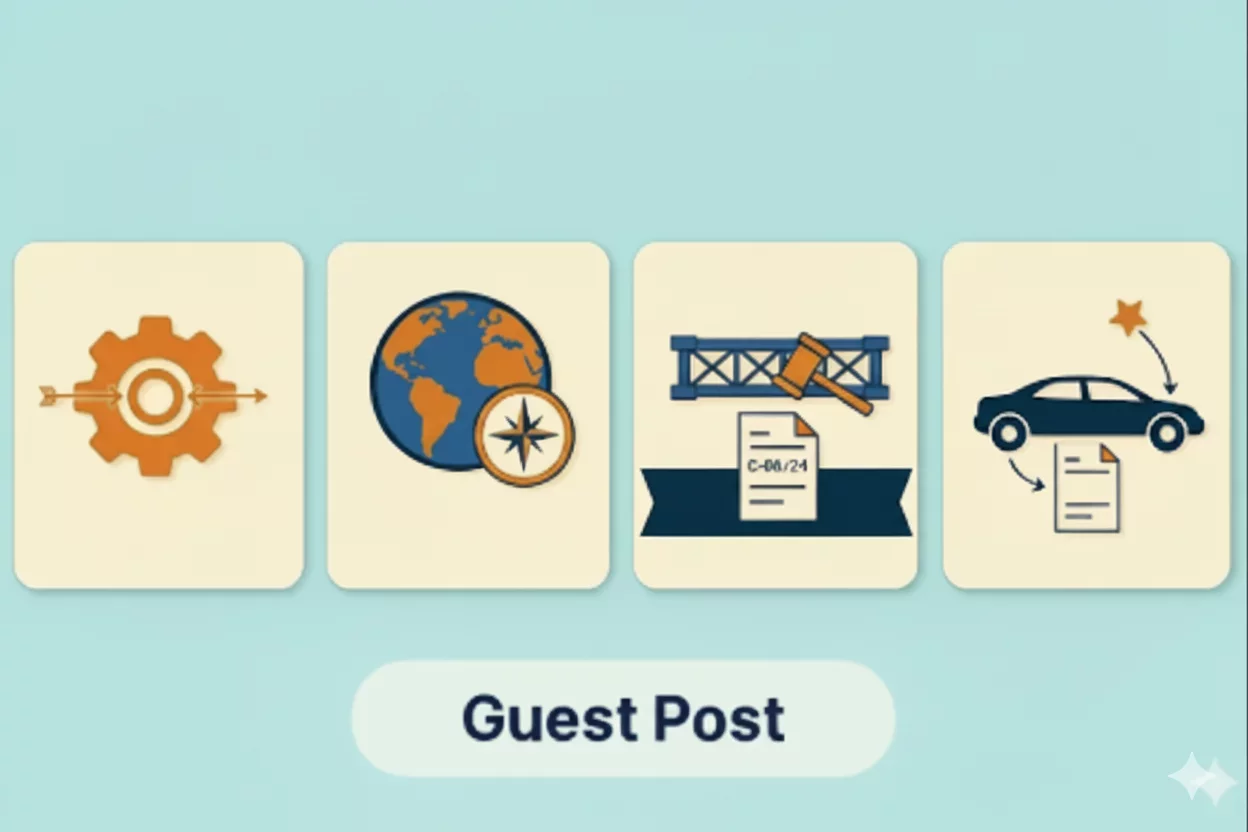
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



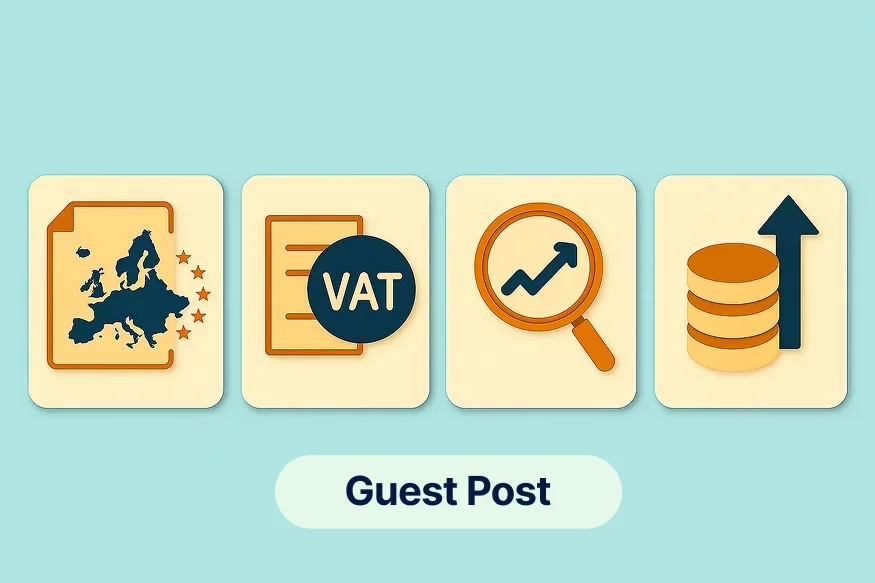
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

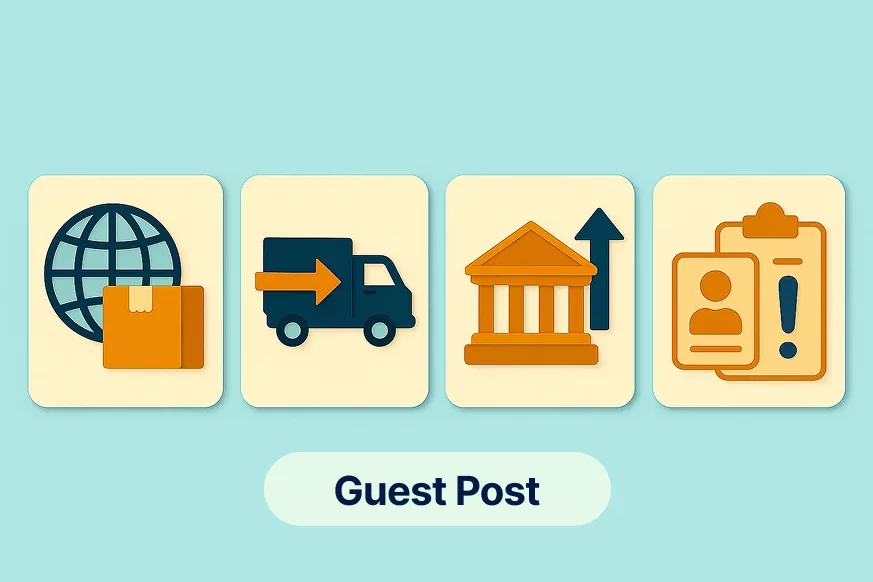
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
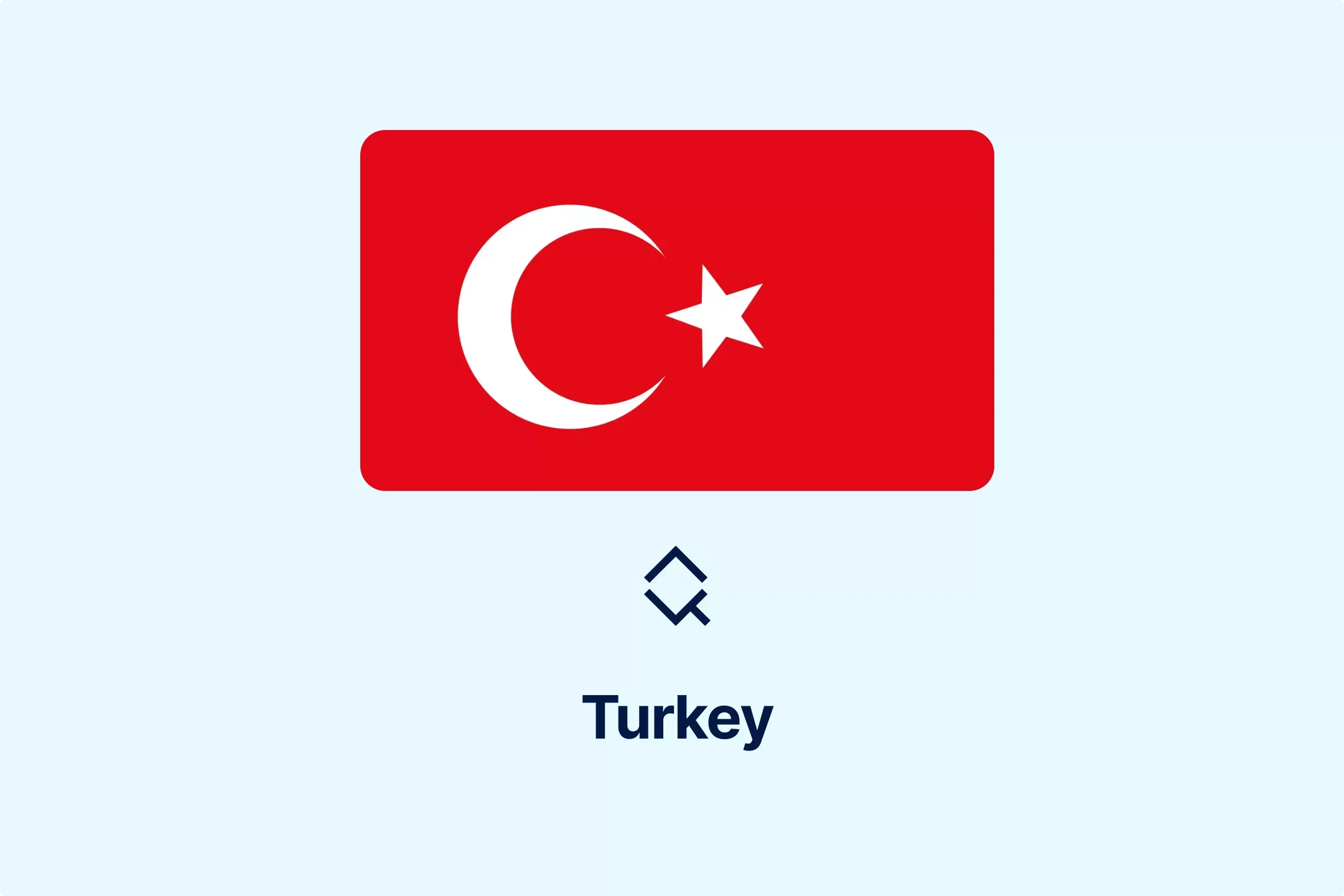
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)







-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

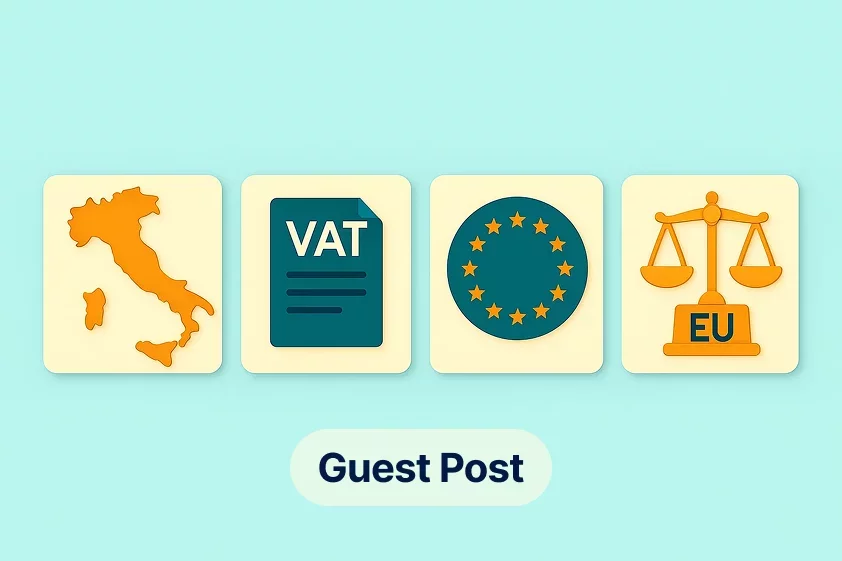

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





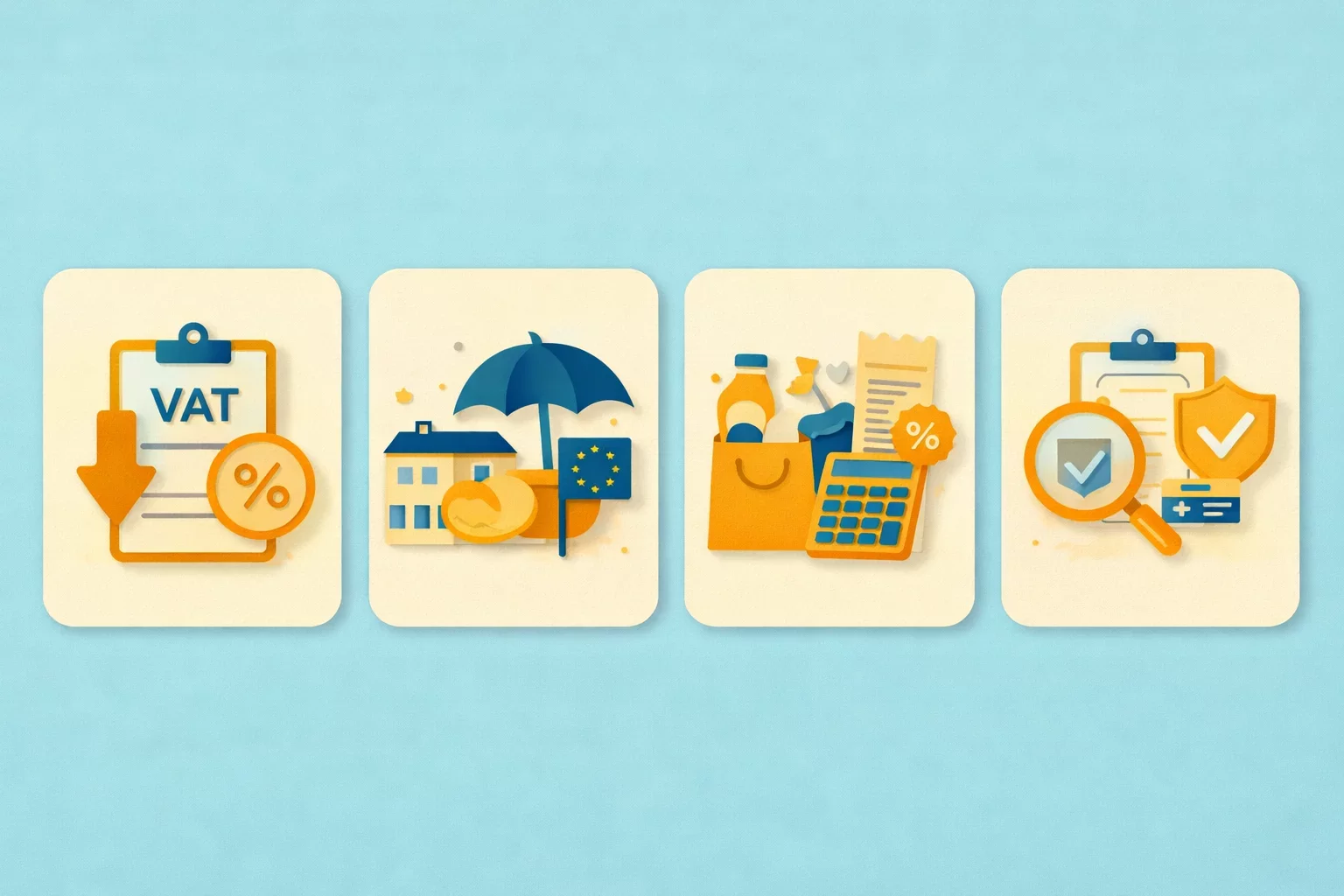
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)




-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)




































































































































