Gesamtschuldnerische Haftung für Mehrwertsteuerschulden: CJEU-Urteil C-278/24

Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache C-278/24 [Genzyński] betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen nationalen Steuervollstreckungsmaßnahmen und EU-rechtlichen Grundsätzen. Im Kern geht es dabei um die Vereinbarkeit der polnischen Vorschriften über die gesamtschuldnerische Haftung von Unternehmensleitern für Mehrwertsteuerschulden mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der Rechtssicherheit, dem Recht auf Eigentum und dem Grundsatz der Gleichbehandlung nach EU-Recht.
Der Streitfall beleuchtet die Grenzen des Ermessensspielraums der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie und Artikel 325 AEUV bei der Gestaltung von Mechanismen zur Gewährleistung einer wirksamen Mehrwertsteuererhebung. Die Entscheidung stellt eine wichtige Klarstellung sowohl für die Steuerbehörden als auch für Unternehmensleiter in der gesamten EU dar.
Fakten und Umstände
Der Fall ergab sich aus den Bemühungen der polnischen Steuerbehörden, nicht gezahlte Mehrwertsteuer von E. sp. z o.o. (Unternehmen E.), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zurückzufordern. Die Schlüsselfigur war P. K., der zwischen Januar 2014 und September 2017 als Vorstandsvorsitzender fungierte.
Zwischen Mai 2017 und August 2017 führte die Firma E. keine Mehrwertsteuer ab, was zu Steuerrückständen führte. Der Leiter des niederschlesischen Finanzamts erließ Vollstreckungstitel, stellte das Verfahren jedoch ein, nachdem er festgestellt hatte, dass das Vermögen des Unternehmens nicht ausreichte, um die Schulden zu begleichen.
Nach polnischem Recht - insbesondere Artikel 107, 108 und 116 des Steuergesetzbuchs - können die Steuerbehörden Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch für Steuerrückstände des Unternehmens haftbar machen, wenn die Vollstreckung gegen das Unternehmen scheitert, es sei denn, das Mitglied kann einen von mehreren Befreiungsgründen nachweisen. Zu diesen Gründen gehören:
1. die rechtzeitige Stellung eines Insolvenzantrags
2. der Nachweis, dass das Versäumnis, Insolvenz anzumelden, nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist; oder
3. die Identifizierung von Unternehmensvermögen, mit dem die Steuerschuld beglichen werden könnte.
Am 15. Juni 2022 erklärte das Finanzamt P.K. für gesamtschuldnerisch haftbar. Die Entscheidung wurde in der Berufung vor dem Direktor der Steuerverwaltungskammer bestätigt. P.K. focht die Entscheidung vor dem Regionalen Verwaltungsgericht in Wrocław an und argumentierte, dass:
- Zum maßgeblichen Zeitpunkt habe es keine rechtlichen oder tatsächlichen Gründe für die Beantragung der Insolvenz gegeben;
- Nach polnischem Insolvenzrecht sind für ein Insolvenzverfahren mindestens zwei Gläubiger erforderlich, so dass ein Antrag zwecklos ist, wenn nur ein Gläubiger vorhanden ist;
- Die Behörden gingen von einer Haftungsvermutung aus, ohne sein Verhalten oder Verschulden zu prüfen.
Das vorlegende Gericht sah potenzielle Konflikte mit dem EU-Recht und stellte fest, dass die polnische Praxis die Geschäftsführer im Wesentlichen dazu zwingt, auch dann einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn ein solcher Antrag rechtlich unwirksam wäre (z. B. wenn die Staatskasse der einzige Gläubiger ist), und dass ein Versäumnis die Befreiung von der Haftung verhindert.
Rechtlicher Rahmen
Der in diesem Fall geltende Rechtsrahmen umfasst sowohl Bestimmungen des EU-Rechts als auch des polnischen Rechts. Nach Artikel 193 der Mehrwertsteuerrichtlinie ist der Steuerpflichtige, der Gegenstände liefert oder Dienstleistungen erbringt, zur Zahlung der Mehrwertsteuer verpflichtet. Artikel 205 derselben Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit ein, unter bestimmten Umständen andere Personen gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Mehrwertsteuer zu haften. Dieser Ermessensspielraum wird durch Artikel 273 erweitert, der die Mitgliedstaaten ermächtigt, zusätzliche Pflichten einzuführen, die sie für erforderlich halten, um die ordnungsgemäße Erhebung der Mehrwertsteuer zu gewährleisten und Steuerhinterziehung zu verhindern, sofern diese Maßnahmen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung wahren.
Auf Vertragsebene erlegt Artikel 325 AEUV den Mitgliedstaaten die Pflicht auf, Betrug zu bekämpfen und die finanziellen Interessen der EU durch wirksame und abschreckende Maßnahmen zu schützen. Auch die Grundrechte spielen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit solcher nationalen Vorschriften. In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sind in Artikel 17 das Recht auf Eigentum, in den Artikeln 20 und 21 die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung und in Artikel 47 das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf verankert - was hier im Zusammenhang mit den Verfahrensgarantien für Personen, die sich einer Haftung gegenübersehen, von Bedeutung ist.
Im polnischen Rechtskontext sieht Artikel 116 der Abgabenordnung einen Mechanismus vor, nach dem Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands eines Unternehmens persönlich für die Steuerrückstände des Unternehmens haftbar gemacht werden können, wenn die Vollstreckung in das Vermögen des Unternehmens fehlgeschlagen ist, es sei denn, sie können besondere Gründe für eine Befreiung nachweisen, wie etwa die rechtzeitige Stellung eines Insolvenzantrags oder den Nachweis, dass das Versäumnis nicht auf sie zurückzuführen ist. Das Insolvenzgesetz ergänzt diesen Rahmen, indem es die Pflicht vorsieht, innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt der Insolvenzvoraussetzungen einen Insolvenzantrag zu stellen, wobei die Insolvenz vermutet wird, wenn der Zahlungsverzug des Schuldners mehr als drei Monate beträgt.
Standpunkte der Parteien und Rechtsfrage
In dem Verfahren vor dem vorlegenden Gericht machte P.K. geltend, dass während seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender keine rechtliche Verpflichtung bestanden habe, einen Insolvenzantrag zu stellen, da die gesetzlichen Voraussetzungen für einen solchen Antrag nicht erfüllt gewesen seien. Er betonte, dass nach polnischem Insolvenzrecht und gängiger Praxis die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, wenn es nur einen einzigen Gläubiger - in diesem Fall die Steuerbehörde - gibt, rechtlich unwirksam wäre, da das Gericht einen solchen Antrag ablehnen würde. Die Steuerbehörden hätten sich auf eine allgemeine Haftungsvermutung gestützt, die allein an den Zeitraum der Entstehung der Steuerschuld anknüpfe, ohne sein Verhalten zu prüfen oder ein tatsächliches Verschulden festzustellen.
Die polnische Steuerbehörde vertrat die gegenteilige Auffassung und vertrat die Ansicht, dass die gesetzlichen Vorschriften einheitlich auf alle Geschäftsführer anwendbar seien und dass P.K. keine der in der Abgabenordnung festgelegten Befreiungsvoraussetzungen erfüllt habe. Selbst wenn ein Insolvenzantrag letztlich vom Gericht abgewiesen werde, erfülle die Antragstellung die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Befreiung.
Das vorlegende Gericht äußerte Zweifel an der Vereinbarkeit eines solchen Systems mit dem EU-Recht und äußerte insbesondere drei Bedenken:
1. ob es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt, wenn keine ausdrückliche Beurteilung des Verschuldens erforderlich ist;
2. ob es die Rechtssicherheit und den Vertrauensschutz untergräbt, indem es die Geschäftsführer zwingt, einen Insolvenzantrag zu stellen, der in der Praxis ohne rechtliche Wirkung ist;
3. ob sie zu einer Ungleichbehandlung zwischen Geschäftsführern von Unternehmen mit einem einzigen Gläubiger und solchen mit mehreren Gläubigern führt.
Vor diesem Hintergrund lautete die zentrale Rechtsfrage, die dem EuGH vorgelegt wurde, ob Artikel 273 der MwSt-Richtlinie in Verbindung mit Artikel 325 AEUV und den allgemeinen Grundsätzen des EU-Rechts einer nationalen Regelung entgegensteht, die die Geschäftsführer von Unternehmen persönlich für Mehrwertsteuerschulden haftbar macht, ohne dass ein Verschulden festgestellt wird, und die die Befreiung von dieser Haftung von der Stellung eines Insolvenzantrags abhängig macht, der unter den gegebenen Umständen rechtsunwirksam wäre.
Die Analyse des Gerichtshofs
Der Gerichtshof stellte zunächst klar, dass die Artikel 193 und 205 der Mehrwertsteuerrichtlinie hier nicht einschlägig sind, da sie die Ermittlung des Mehrwertsteuerschuldners für bestimmte Umsätze betreffen, während es im vorliegenden Fall um die Beitreibung einer bestehenden Mehrwertsteuerschuld durch die Haftung des Geschäftsführers ging. Der Schwerpunkt lag daher auf Artikel 273, der es den Mitgliedstaaten erlaubt, zusätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen, um die Erhebung der Mehrwertsteuer sicherzustellen und Steuerhinterziehung zu verhindern, sofern diese Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit und die Gleichbehandlung wahren und nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist.
Zur Verhältnismäßigkeit stellte der Gerichtshof fest, dass die polnische Regelung die Mehrwertsteuereinnahmen rechtmäßig sichert. Die Vermutung, dass die Geschäftsführer Kenntnis von und Einfluss auf die Angelegenheiten des Unternehmens haben, ist akzeptabel, solange diese Vermutung widerlegt werden kann. Die Geschäftsführer müssen entweder nachweisen können, dass sie die Insolvenz rechtzeitig angemeldet haben oder dass die Nichtanmeldung nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen ist. Der Gerichtshof betonte, dass eine Mehrwertsteuerschuld allein die Pflicht zur Antragstellung nicht auslöst; die finanzielle Lage des Unternehmens muss sich bis zur Insolvenz verschlechtert haben. Da das System eine Widerlegung zulässt, ist die Haftung nicht absolut.
In Bezug auf die Gleichbehandlung wies der Gerichtshof die Auffassung zurück, dass Geschäftsführer von Unternehmen mit nur einem Gläubiger benachteiligt sind, da die entscheidende Voraussetzung die Handlung des Insolvenzantrags und nicht dessen Ergebnis ist. Automatische Ausnahmen für Situationen, in denen es nur einen Gläubiger gibt, könnten jedoch Manipulationen zur Umgehung der Mehrwertsteuerpflicht begünstigen und würden eine wirksame Steuererhebung untergraben.
Der Gerichtshof bestätigte auch, dass die Vorschriften die Anforderungen an die Rechtssicherheit erfüllen: Sie sind klar und vorhersehbar und ermöglichen es den Geschäftsführern, vorauszusehen, wann eine Haftung eintreten kann und wie sie diese vermeiden können.
Was schließlich das Eigentumsrecht nach Artikel 17 der Charta betrifft, so räumte der Gerichtshof ein, dass eine solche Haftung das Privatvermögen berührt, hielt den Eingriff jedoch für gerechtfertigt. Er dient einem legitimen öffentlichen Interesse, entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellt einen gerechten Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten Interessen her. Die Haftung ist auf Beträge beschränkt, die vom Unternehmen nicht zurückgefordert werden können, wobei Verfahrensgarantien vorgesehen sind.
Praktische Auswirkungen
Aus dem Urteil lassen sich wichtige Lehren für Unternehmensleiter in der gesamten EU ziehen, insbesondere in Ländern mit ähnlichen Vorschriften zur persönlichen Haftung für Steuerschulden. Es bestätigt, dass die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die Vermutung zulassen, dass die Geschäftsführer von der Einhaltung der Steuervorschriften durch das Unternehmen Kenntnis haben und darauf Einfluss nehmen, doch muss diese Vermutung stets widerlegbar sein, so dass die Geschäftsführer eine echte Chance haben, nachzuweisen, dass sie kein Verschulden trifft.
Für die Geschäftsführer bedeutet dies, dass eine genaue Überwachung der Finanzlage des Unternehmens unerlässlich ist. Wenn sich Anzeichen für eine Zahlungsunfähigkeit ergeben, muss schnell gehandelt werden. Selbst in Fällen, in denen die Steuerbehörde der einzige Gläubiger ist, kann die Stellung eines Insolvenzantrags - auch wenn dieser letztendlich abgewiesen werden kann - ein notwendiger Schritt sein, um sich vor persönlicher Haftung zu schützen. Die Weigerung des Gerichtshofs, eine automatische Befreiung in Fällen mit nur einem Gläubiger zu gewähren, schließt eine potenzielle Gesetzeslücke und gewährleistet die Integrität der Mehrwertsteuererhebung.
Praktische Sorgfalt ist ebenso wichtig. Die Geschäftsführer sollten gründliche Aufzeichnungen über alle Entscheidungen und Schritte zur Bewältigung finanzieller Schwierigkeiten führen, einschließlich der Inanspruchnahme professioneller Beratung, da sich diese Dokumentation als entscheidend für den Nachweis der Sorgfalt erweisen kann.
Obwohl der Fall im polnischen Recht verankert ist, hat seine Argumentation grenzüberschreitenden Charakter. Die Mitgliedstaaten müssen ein Gleichgewicht zwischen der wirksamen Erhebung der Mehrwertsteuer und den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit herstellen, und jede Haftungsregelung für Geschäftsführer wird an diesen EU-Rechtsnormen gemessen werden.
Schlussfolgerung
Der EuGH hat in der Rechtssache C-278/24 bestätigt, dass die gesamtschuldnerische Haftung von Geschäftsführern auch ohne strenge Verschuldensanforderungen mit dem EU-Recht in Einklang stehen kann, wenn das System eine echte Widerlegung ermöglicht und die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung und Rechtssicherheit beachtet. Der polnische Rechtsrahmen erfüllt diese Anforderungen, da er die Haftung auf uneinbringliche Forderungen beschränkt, klare Ausnahmen vorsieht und die Vorschriften konsequent anwendet. Für die Geschäftsführer unterstreicht das Urteil die Notwendigkeit eines raschen, gut dokumentierten Handelns bei finanziellen Schwierigkeiten; für die Steuerbehörden bestätigt es entschlossene Beitreibungsmaßnahmen, wenn diese mit angemessenen Schutzmaßnahmen einhergehen.
EuGH - C-278/24 - ECLI:EU:C:2025:299 - Mehrwertsteuerpflicht für Vorstandsvorsitzende nach EU-Recht gültig >>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0278
Ausgewählte Einblicke
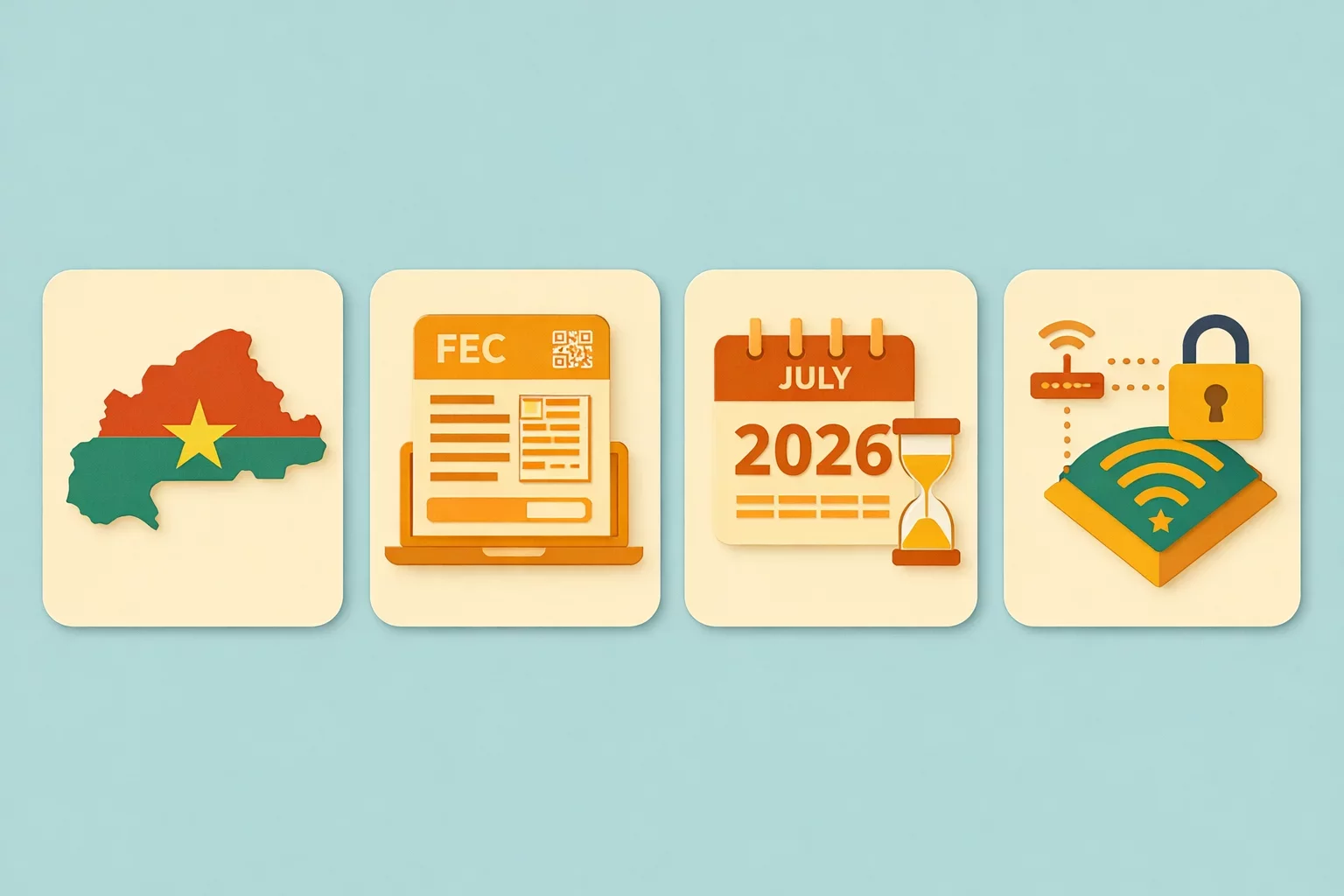
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
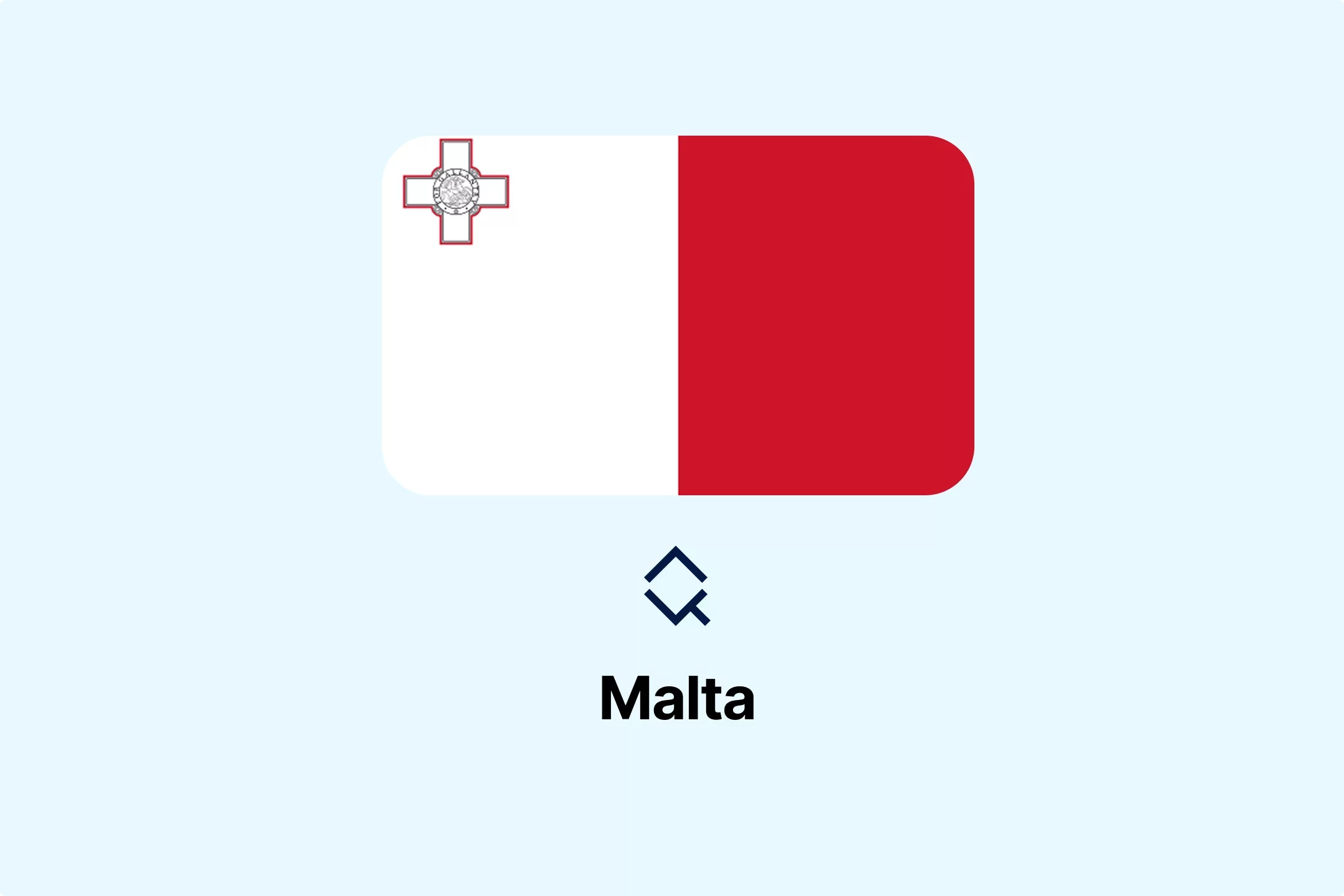
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
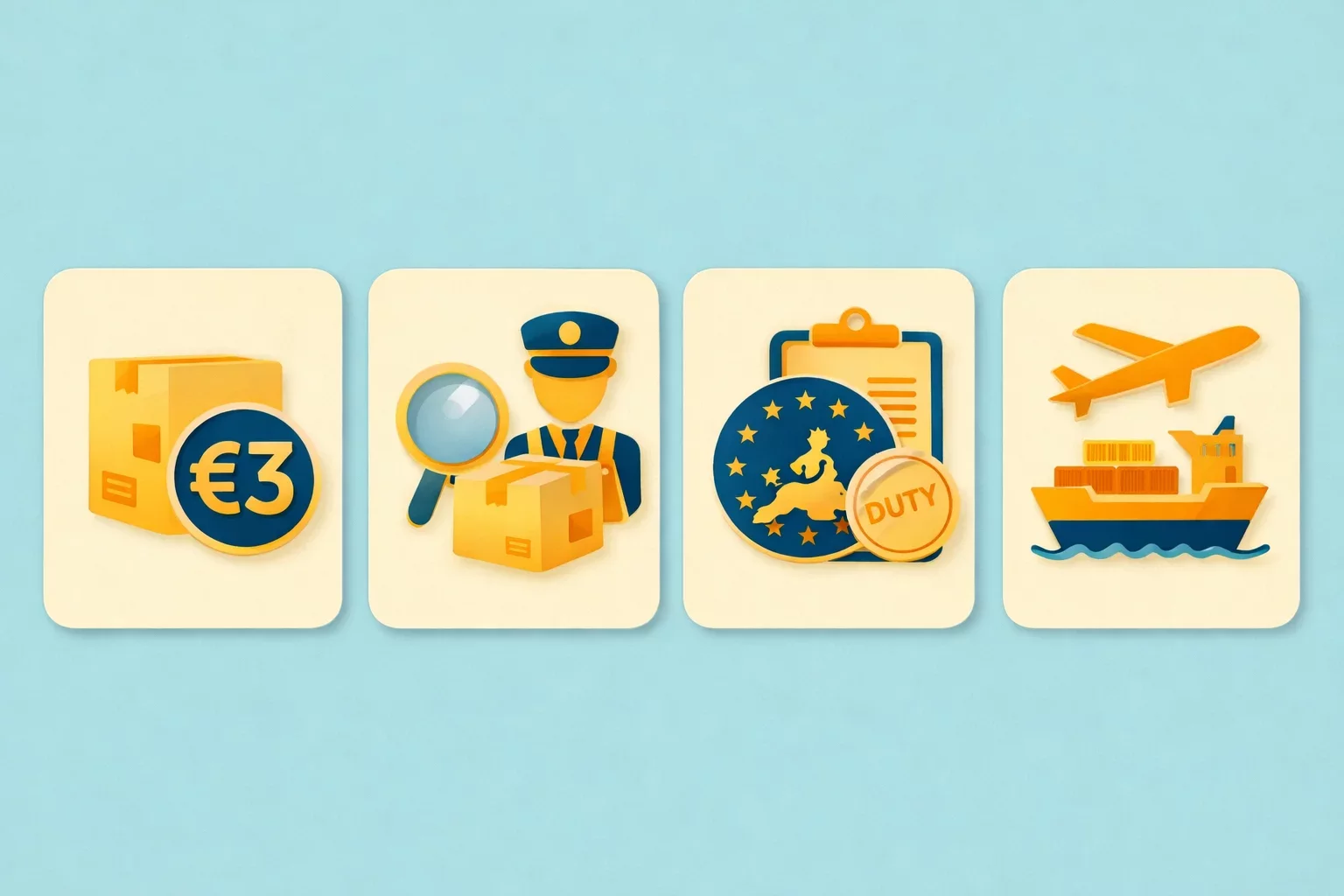


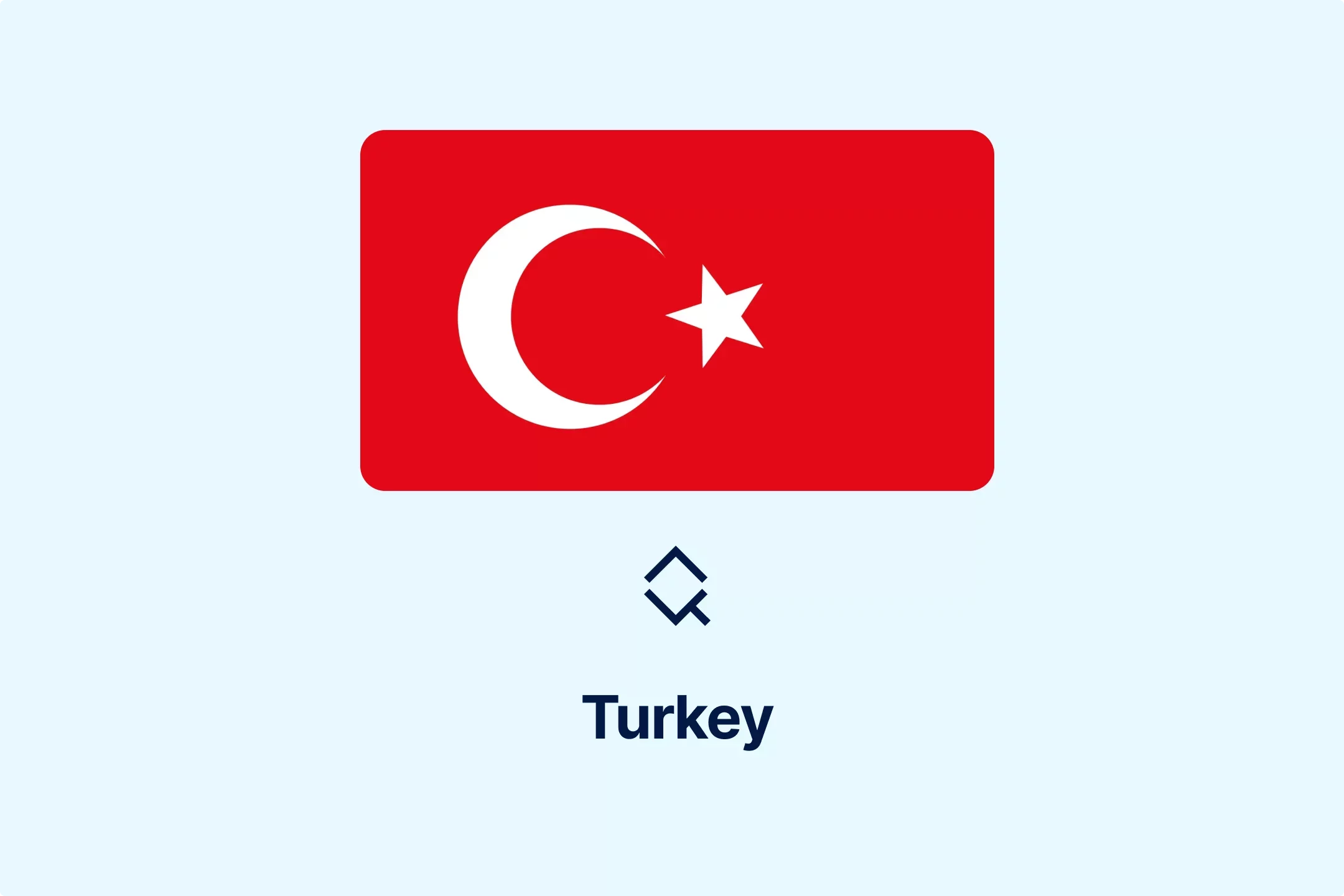




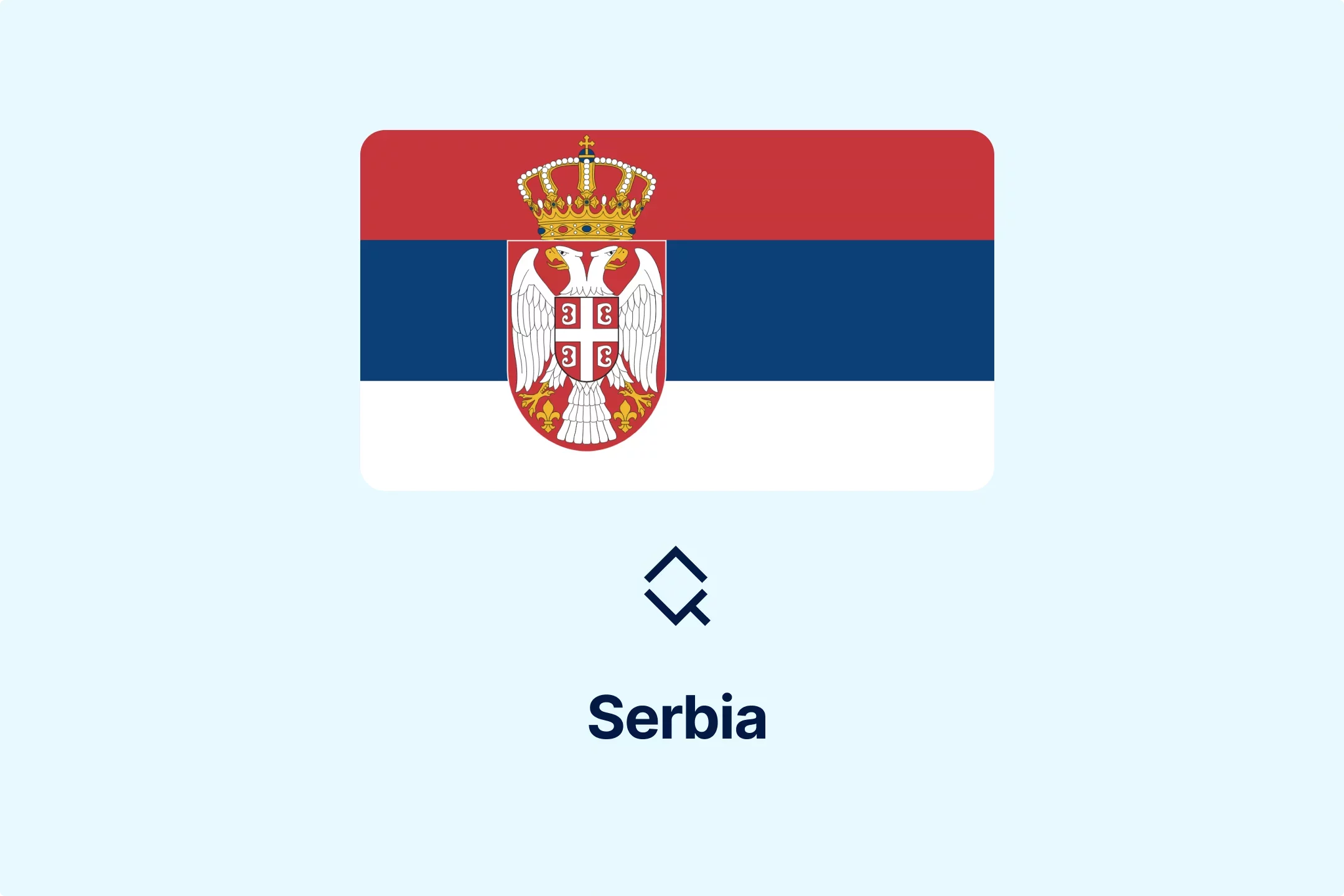
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



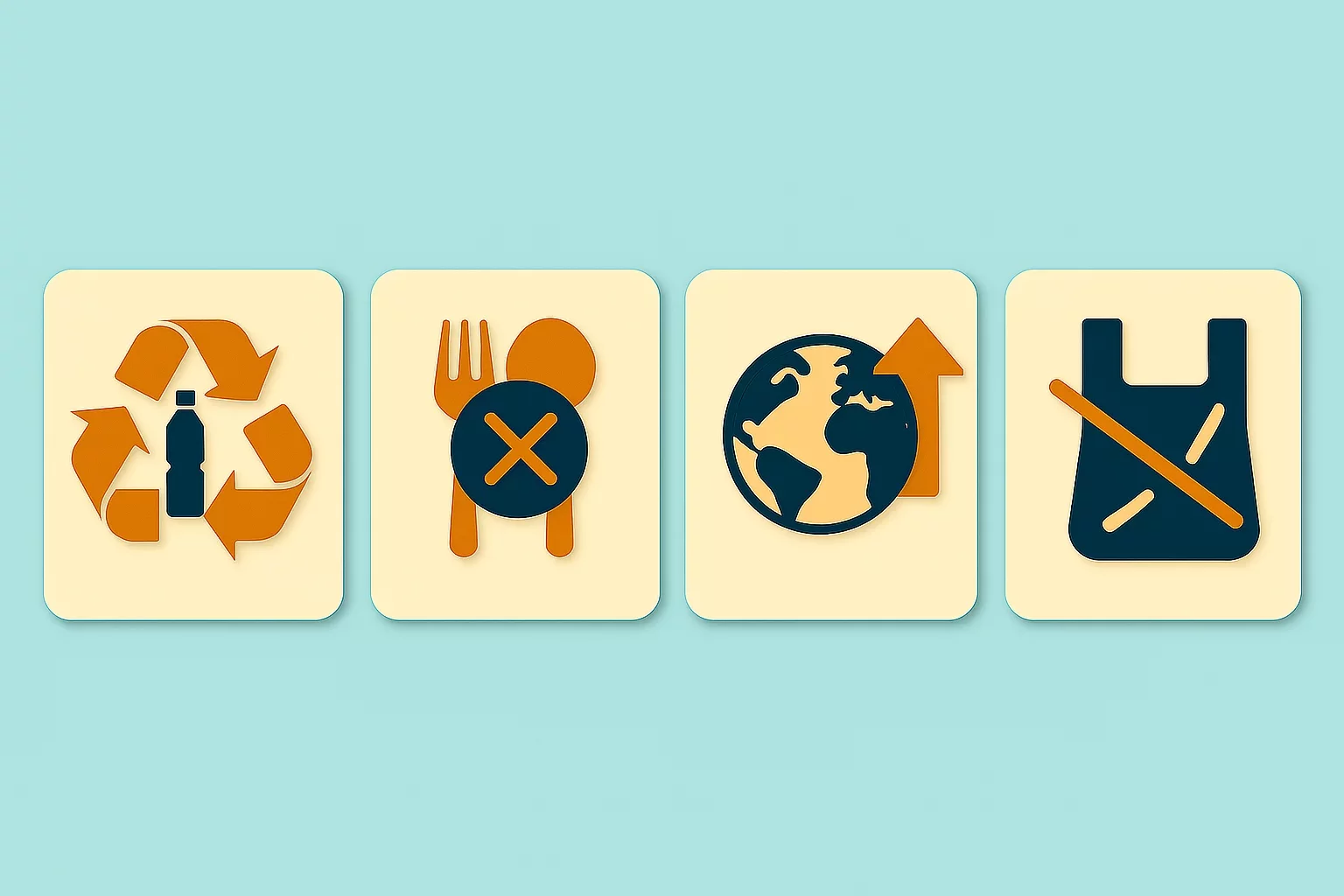


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
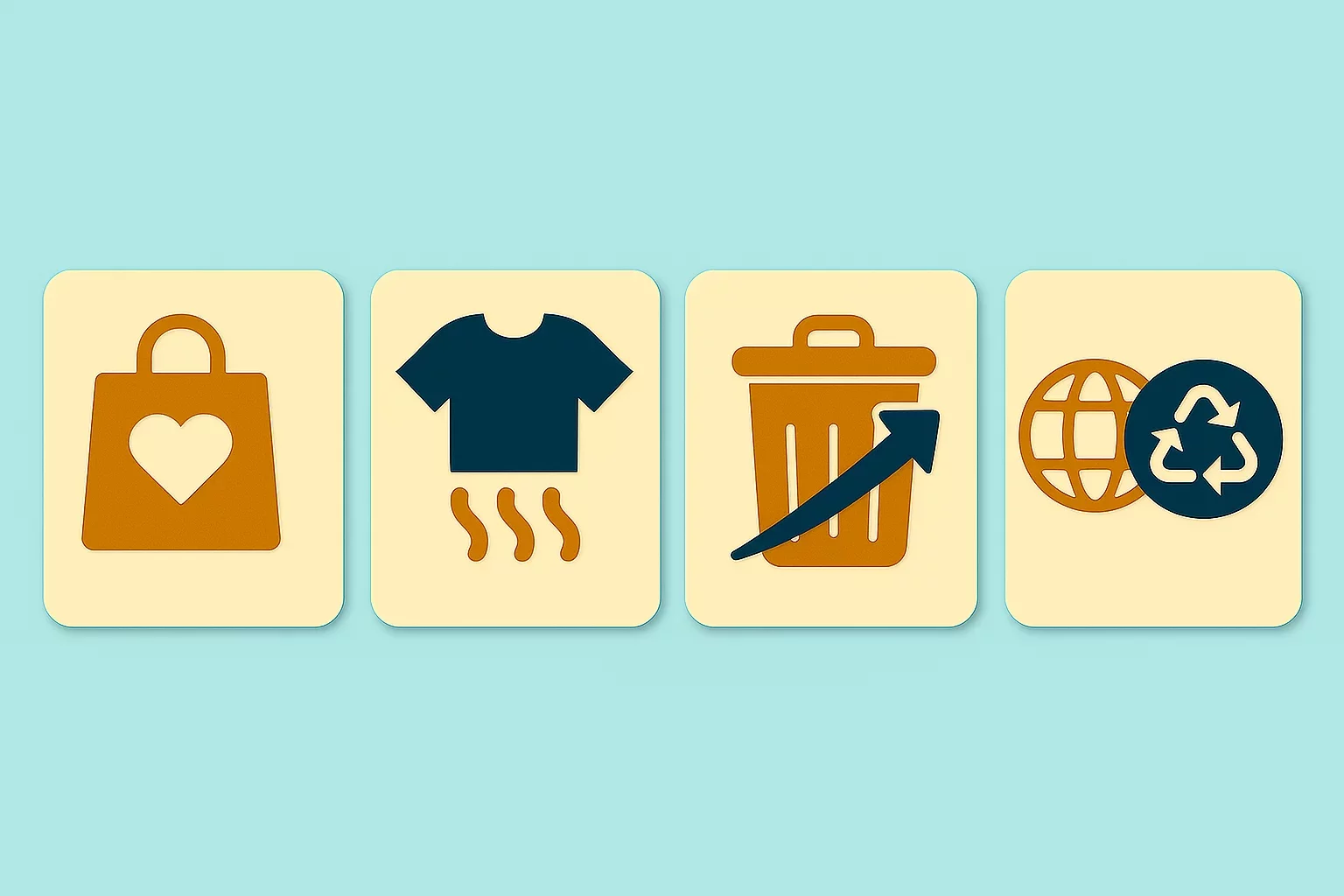

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
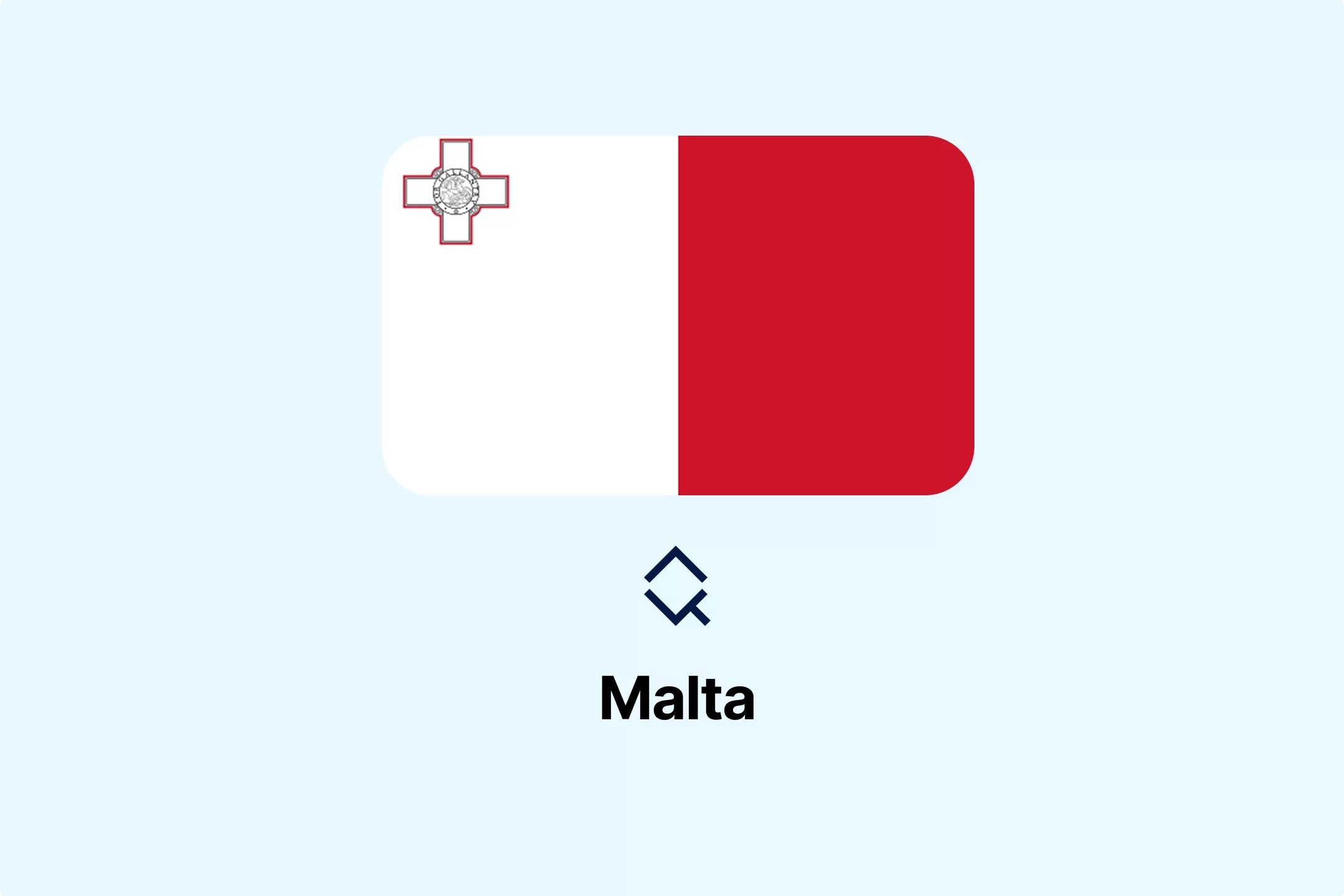
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
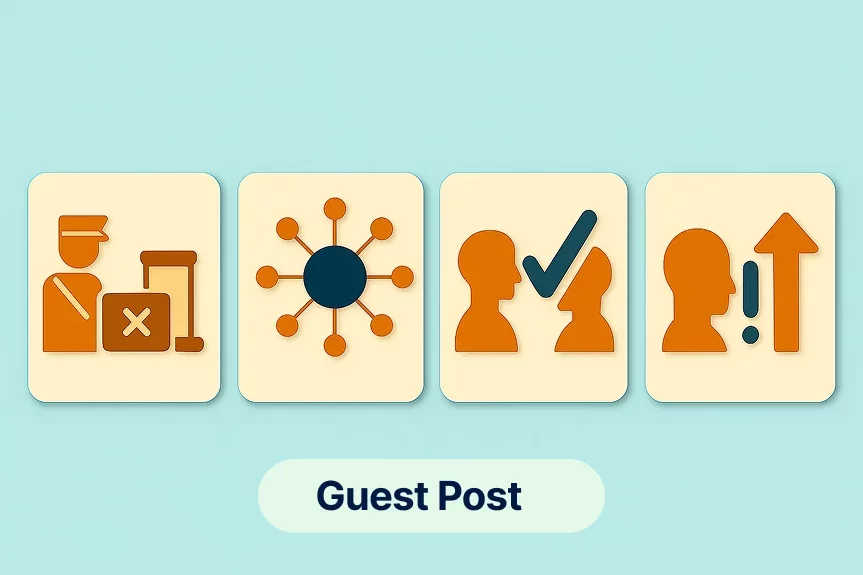

-hafis0ii23.webp)

-qseaw5zmcy.webp)


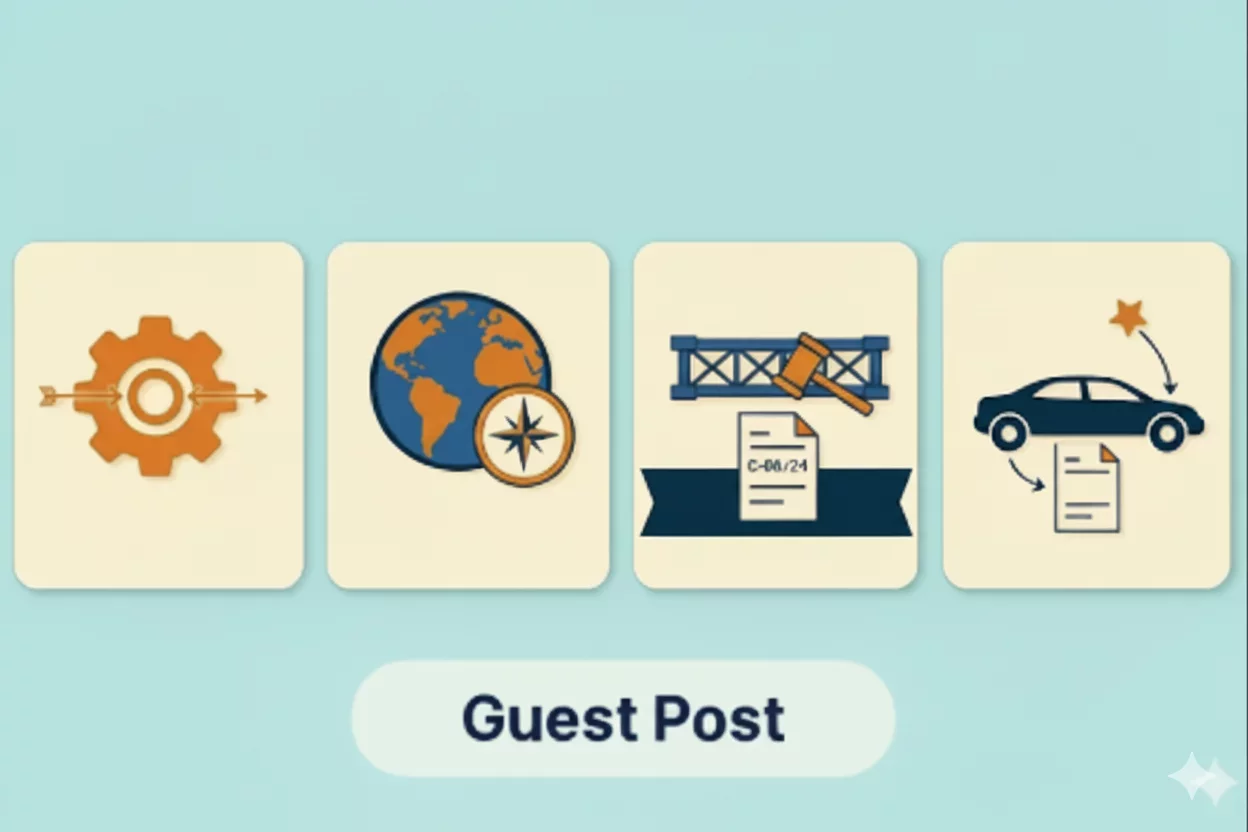
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



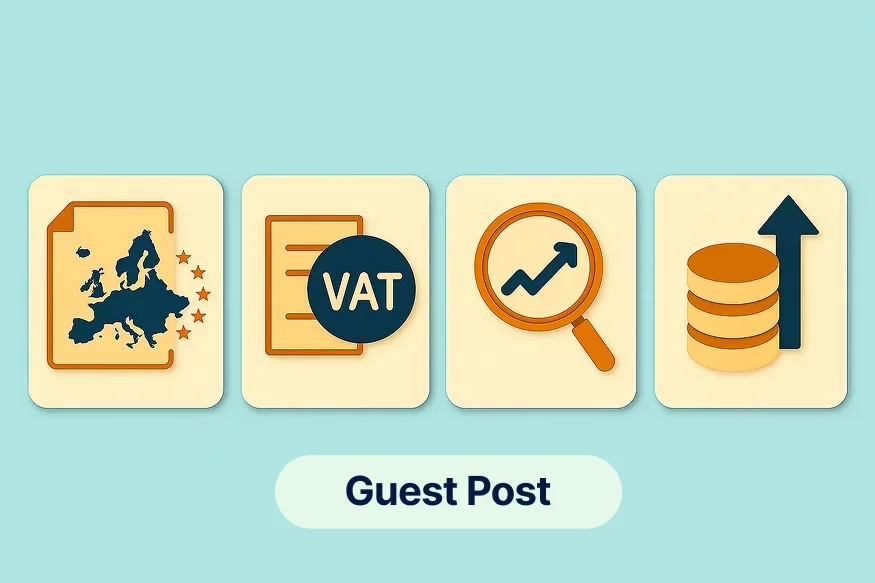
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

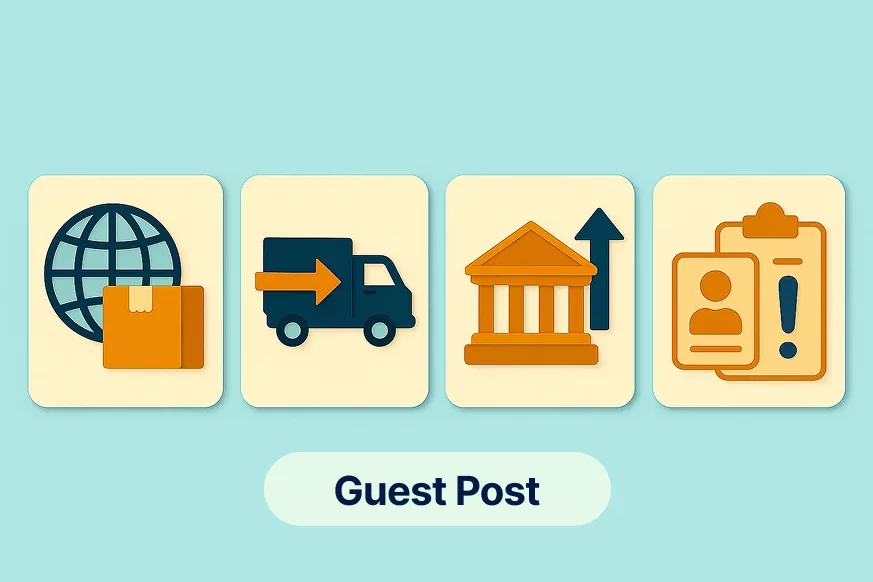
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
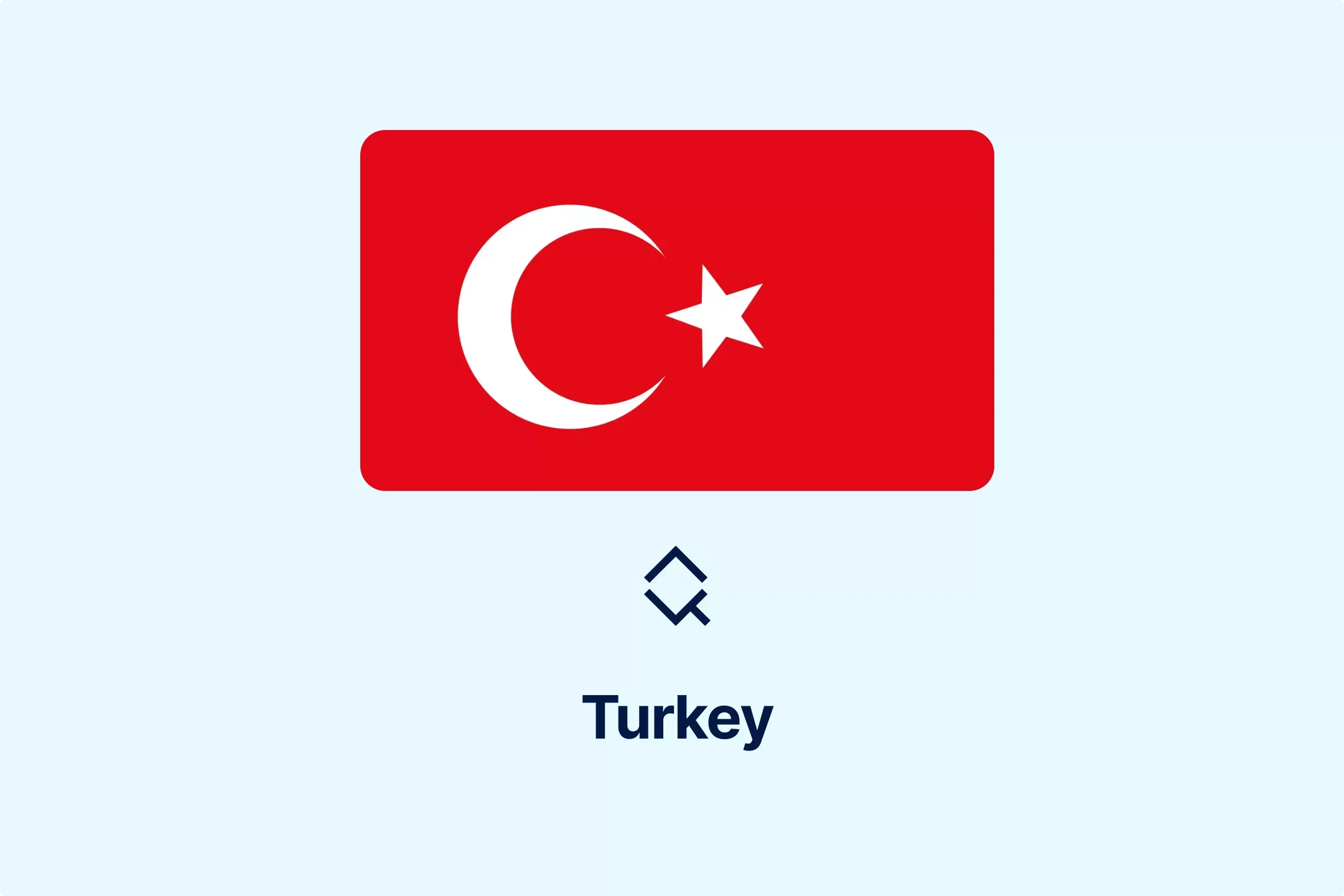
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)







-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

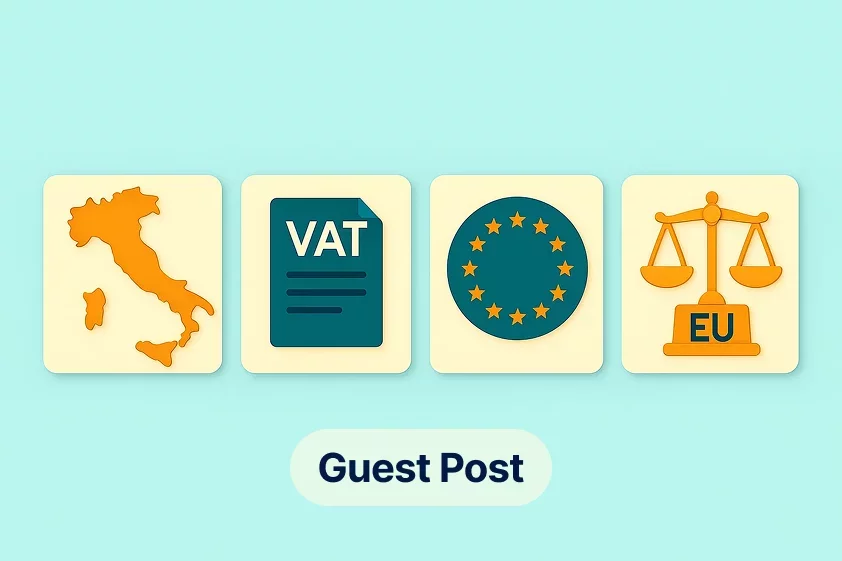

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





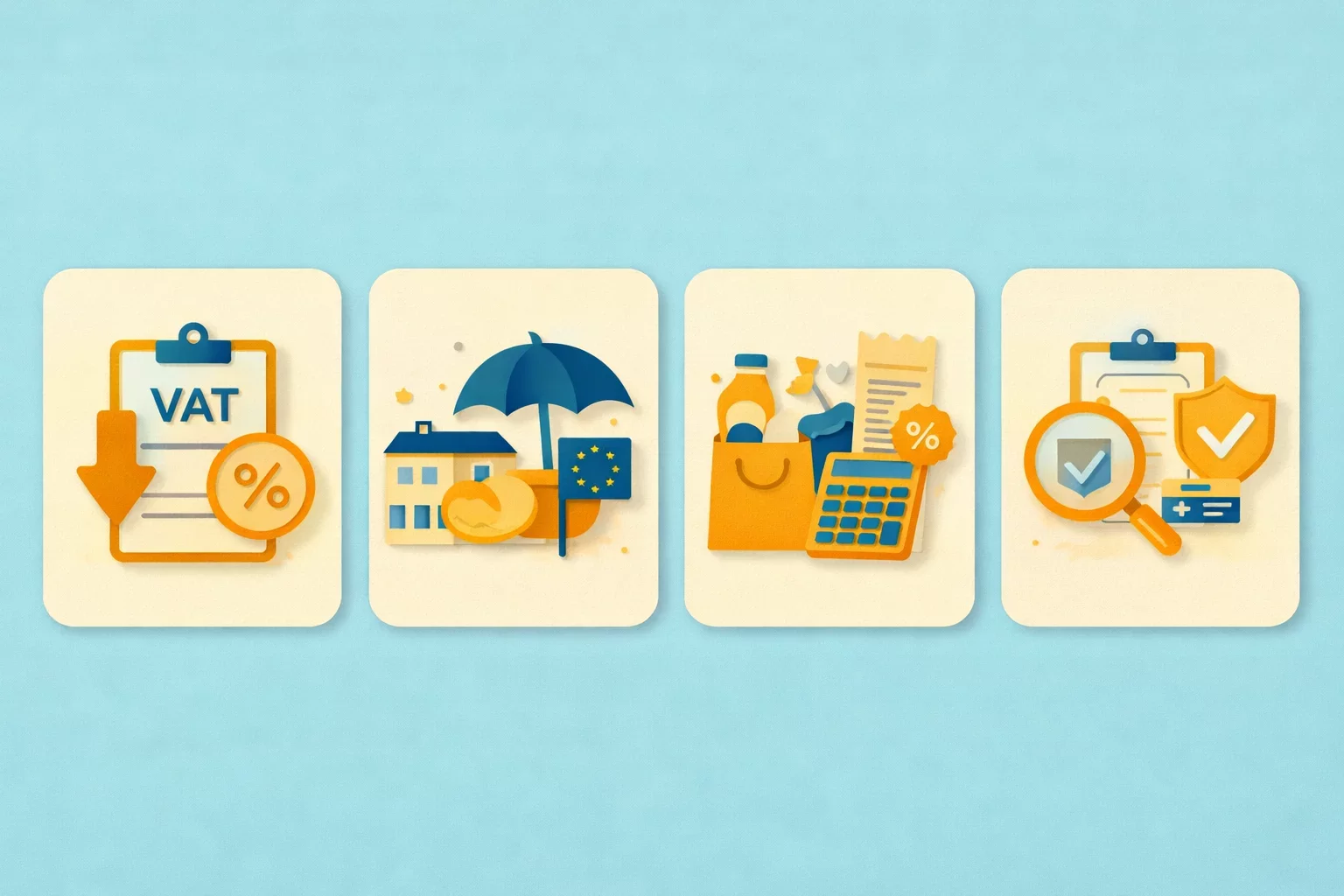
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)




-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)




































































































































