EuGH entscheidet über rückwirkende Korrekturen der Mehrwertsteuersätze: Lehren aus der Rechtssache C-794/23

🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
In dem Fall zwischen dem in Österreich ansässigen Unternehmen P, das einen Indoor-Spielplatz betreibt, und dem österreichischen Finanzamt geht es um die Frage, ob eine rückwirkende Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes zulässig ist, nachdem zunächst der normale Mehrwertsteuersatz auf Eintrittsgelder berechnet wurde.
Genauer gesagt geht es in diesem Fall um die wichtigsten Bedingungen, unter denen die Mehrwertsteuer nach der Rechnungsstellung und Zahlung berichtigt werden kann, insbesondere wenn der Kundenstamm hauptsächlich aus Endverbrauchern besteht, die die Mehrwertsteuer nicht zurückfordern können. Darüber hinaus bezieht sich die Rechtssache auf einen früheren Rechtsstreit zwischen diesen Parteien in derselben Angelegenheit, der 2022 beigelegt wurde, was diesen Fall noch interessanter macht.
Hintergrund der Rechtssache
Unternehmen P wendete im Jahr 2019 auf Eintrittsgelder für den Spielplatz einen Mehrwertsteuer-Normalsatz von 20 % an. Außerdem stellt das Unternehmen seinen Kunden vereinfachte Kassenbelege aus, wie es das österreichische Umsatzsteuerrecht für Umsätze mit geringem Wert zulässt, und weist die entsprechende Steuer in seiner Umsatzsteuererklärung aus. Später berichtigte das Unternehmen jedoch seine Mehrwertsteuererklärungen und machte geltend, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 13 % anstelle des normalen Mehrwertsteuersatzes von 20 % hätte angewendet werden müssen.
Im Januar 2021 lehnte das österreichische Finanzamt die berichtigten MwSt-Erklärungen mit der Begründung ab, dass der MwSt-Satz von 20 % gelte und dass das Unternehmen die bereits ausgestellten vereinfachten Rechnungen nicht ändern oder Gutschriften für die MwSt-Differenz ausstellen könne. Das Finanzamt fügte außerdem hinzu, dass eine rückwirkende Senkung des Mehrwertsteuersatzes zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Unternehmens führen würde.
Das Unternehmen, das mit dieser Schlussfolgerung nicht einverstanden war, legte Einspruch gegen die Entscheidung ein und argumentierte, dass seine Dienstleistungen fast ausschließlich an Privatpersonen erbracht würden, die die Vorsteuer nicht zurückfordern könnten, so dass keine Gefahr eines Steuerausfalls für den Staat bestehe und eine Rechnungskorrektur nicht erforderlich sei.
Im Juni 2021 legte das österreichische Bundesfinanzgericht dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine Frage vor, um zu klären, ob Artikel 203 der MwSt-Richtlinie in diesem Fall anwendbar ist, obwohl kein Risiko eines Steuerausfalls bestand. In seiner Entscheidung in der Rechtssache C-378/21 entschied der EuGH, dass ein Steuerpflichtiger, der in einer Rechnung einen falschen Mehrwertsteuersatz in Rechnung stellt, nicht für den zu viel berechneten Betrag haftet, wenn keine Gefahr eines Steuerausfalls besteht.
Im Anschluss an die Argumentation und Entscheidung des EuGH revidierte der Bundesfinanzhof seine frühere Position und änderte im Januar 2023 den Umsatzsteuerbescheid 2019 des Unternehmens entsprechend. Allerdings ging der Bundesfinanzhof bei dieser Entscheidung davon aus, dass alle Leistungen des Unternehmens ausschließlich von Endverbrauchern in Anspruch genommen werden, die keinen Vorsteuerabzug geltend machen können.
In Wirklichkeit konnte nicht völlig ausgeschlossen werden, dass einige Kunden Vorsteuerabzüge geltend gemacht haben. Daher beschloss der Bundesfinanzhof zu schätzen, wie viele Rechnungen eine Mehrwertsteuerschuld nach Artikel 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie begründen könnten. Die endgültige Schätzung ergab, dass 0,5 % des Gesamtumsatzes, d. h. etwa 112 von 22 557 Rechnungen, ein potenzielles Risiko von Steuerausfällen darstellen.
Die Steuerbehörde legte jedoch gegen diese Entscheidung Berufung beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof ein und machte geltend, dass der Ansatz des Bundesfinanzhofs im Widerspruch zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-378/21 stehe. Darüber hinaus argumentierte die Steuerbehörde, dass die Entscheidung des EuGH eine Aufteilung der steuerpflichtigen Umsätze auf der Grundlage von Schätzungen, welche Kunden Endverbraucher und welche Steuerpflichtige sind, nicht zulässt.
Aufgrund dieser Umstände, einer unbeantworteten Frage zu den Kriterien, die bei der Bestimmung der Rechnungen, bei denen die Gefahr eines Steuerausfalls besteht, herangezogen werden müssen, und der Ungewissheit darüber, wie der im EuGH-Urteil von 2022 verwendete Begriff "Endverbraucher, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind" auszulegen ist, hat das Oberste Verwaltungsgericht das Verfahren unterbrochen und dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Die wichtigsten Fragen aus dem Ersuchen um Vorabentscheidung
Die erste Frage zielt darauf ab, ob ein Steuerpflichtiger, der eine Rechnung mit einem falschen Mehrwertsteuersatz ausstellt, für die zu viel berechnete Mehrwertsteuer haftet, wenn die betreffende Dienstleistung an einen Nichtsteuerpflichtigen erbracht wurde, selbst wenn die gleiche Art von Dienstleistung auch an Steuerpflichtige erbracht wurde.
Die zweite Frage, die der EuGH gestellt hat, betrifft die Frage, wie ein "Endverbraucher ohne Recht auf Vorsteuerabzug" in der Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2022 zu definieren ist. Konkret wollte das Oberste Verwaltungsgericht wissen, ob sich dieser Begriff nur auf Nichtsteuerpflichtige bezieht oder auch Steuerpflichtige umfasst, die die Dienstleistung privat oder für Zwecke nutzen, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Die letzte, dritte Frage betrifft die vereinfachte Rechnungsstellung nach Artikel 238 der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie und fragt, nach welchen Kriterien - möglicherweise durch Schätzung - bestimmt werden soll, welche Rechnungen keine Mehrwertsteuerschuld begründen, weil kein Risiko eines Steuerausfalls besteht.
Anwendbarer Artikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
Neben den Artikeln 203 und 238, die in der ersten und dritten Vorlagefrage direkt zitiert werden, hat der EuGH auch die Artikel 193 und 220 Absatz 1 als die für den vorliegenden Fall relevantesten herausgestellt.
Nach Artikel 193 muss jeder Steuerpflichtige, der eine steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen oder eine steuerpflichtige Dienstleistung bewirkt, die Mehrwertsteuer entrichten, es sei denn, die Zuständigkeit für die Zahlung geht nach besonderen Bestimmungen auf einen anderen über. In den Artikeln 203, 220 Absatz 1 und 238 sind die Rechnungsstellungsvorschriften und ihre Auswirkungen auf die mehrwertsteuerlichen Pflichten und Verbindlichkeiten festgelegt.
Österreichs nationale MwSt-Vorschriften
Was das österreichische Mehrwertsteuergesetz betrifft, so waren die Artikel 11(1), (6) und (12) sowie 16(1) für die Festlegung der nationalen Vorschriften und Regelungen am wichtigsten. In diesen Artikeln werden die Anforderungen für die Ausstellung von Rechnungen festgelegt, es wird bestimmt, wann und wer vereinfachte Rechnungen ausstellen darf, wer dafür verantwortlich ist, wenn ein Steuerbetrag auf einer Rechnung falsch ausgewiesen wird und nicht berichtigt wird, und wie Berichtigungen behandelt werden.
Darüber hinaus wurde auch Artikel 239a der Bundesabgabenordnung (AO) als wesentlich für diesen Fall angeführt, der Handlungen wie die Anrechnung, Rückzahlung oder Umbuchung von Steuerbeträgen verhindert, wenn dies zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Steuerpflichtigen führen würde, insbesondere wenn eine Belastung, die von einer anderen Person getragen werden sollte, bereits von einer anderen Person getragen wurde.
Bedeutung des Falles für Steuerpflichtige
Es gibt mehrere Gründe, warum Steuerpflichtige diesem Fall Aufmerksamkeit schenken sollten. Da ungenaue MwSt-Erklärungen und die falsche Anwendung von MwSt-Sätzen häufiger vorkommen, als den Steuerpflichtigen lieb ist, bieten die Analyse und die Auslegung der geltenden Vorschriften durch den EuGH Rechtssicherheit, wenn solche Situationen auftreten.
Darüber hinaus können Steuerpflichtige, die Rechnungen mit geringem Wert oder vereinfachte Rechnungen ausstellen, von dieser Auslegung profitieren, da sie sie davor schützt, in ungerechtfertigter Weise mit Mehrwertsteuerfehlern belastet zu werden, und gleichzeitig sicherstellt, dass Berichtigungen und Schätzungen gerecht und verhältnismäßig sind und ihre Rechte respektieren.
Analyse der Gerichtsentscheidungen
In Bezug auf die erste Frage hob der EuGH hervor, dass der Zweck von Artikel 203 darin besteht, einen Verlust von Steuereinnahmen zu verhindern, der entsteht, wenn der Rechnungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Außerdem stellte der EuGH klar, dass dieser Artikel nur für den Teil der zu Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer gilt, der den korrekt in Rechnung gestellten Betrag übersteigt, da nur dieser Überschuss ein potenzielles Risiko von Steuerausfällen birgt, wenn der Empfänger zu Unrecht einen Vorsteuerabzug geltend machen könnte.
Das Risiko eines Steuerausfalls besteht, wenn ein steuerpflichtiger Empfänger einen Vorsteuerabzug zu Unrecht geltend machen könnte, ohne dass die Steuerbehörden dessen Gültigkeit überprüfen können. Folglich hängt die Anwendung von Artikel 203 vom Status des Leistungsempfängers für jede einzelne Rechnung ab und nicht davon, ob der Leistungserbringer auch Dienstleistungen an andere Steuerpflichtige erbringt.
Hinsichtlich der Auslegung des Begriffs "Endverbraucher, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind", betonte der EuGH, dass dieser Begriff eng zu verstehen ist. Der EuGH verwies erneut auf die Schutzfunktion von Artikel 203 gegen den Verlust von Steuereinnahmen. Er fügte hinzu, dass ein Steuerpflichtiger, der eine Rechnung mit einem falschen Mehrwertsteuersatz ausstellt, nicht für die überschüssige Mehrwertsteuer haftet, wenn es sich bei den Empfängern ausschließlich um Endverbraucher ohne Recht auf Vorsteuerabzug handelt.
Das Risiko besteht also nur dann, wenn der Empfänger einer unrichtig berechneten Mehrwertsteuer einen Vorsteuerabzug geltend machen könnte, weil komplexe rechtliche oder tatsächliche Umstände die Steuerbehörden daran hindern könnten, rechtzeitig festzustellen, ob der Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Zur dritten Frage stellte der EuGH fest, dass es in diesem Fall um eine große Anzahl von Rechnungen geht, die in einem Massenmarkt ausgestellt werden, in dem die Identität der Empfänger im Allgemeinen unbekannt ist. Daher muss geregelt werden, wie Rechnungen mit geringem Wert zum Zweck der Berichtigung von zu Unrecht in Rechnung gestellter Mehrwertsteuer zu identifizieren sind, insbesondere wenn zu den Empfängern sowohl Endverbraucher als auch zum Vorsteuerabzug berechtigte Steuerpflichtige gehören.
Hierzu fügte der Generalanwalt hinzu, dass die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie weder regelt, wie zu ermitteln ist, welche Rechnungen die Haftung eines Steuerpflichtigen für zu Unrecht in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer begründen, noch regelt sie die Beweislast für eine solche Ermittlung. Die Aufgabe, dies festzulegen, liegt bei den EU-Ländern, die die Kriterien für die Feststellung der Haftung unter Beachtung der EU-Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität festlegen müssen.
Die Gleichwertigkeit stand in diesem Fall nicht zur Debatte. Der EuGH stellte jedoch fest, dass das Oberste Verwaltungsgericht feststellen muss, ob der Grundsatz der Effektivität beachtet wurde, der verlangt, dass die nationalen Vorschriften dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, irrtümlich gezahlte Mehrwertsteuer zu berichtigen oder zurückzufordern, insbesondere wenn keine Gefahr eines Steuerausfalls besteht.
Der EuGH fügte hinzu, dass bei der Ermittlung des Risikos eines Steuerausfalls eine Bewertung auf der Grundlage der einzelnen Rechnungen vorgenommen werden muss, wobei zu berücksichtigen ist, ob der Empfänger ein Steuerpflichtiger für Mehrwertsteuerzwecke ist. Bei der Feststellung, welche Rechnungen mit zu Unrecht in Rechnung gestellter Mehrwertsteuer sich auf andere Steuerpflichtige beziehen, müssen außerdem alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden, wie z. B. die Art der Dienstleistung, die Art und Weise, wie sie erbracht und in Rechnung gestellt wird, sowie alle verfügbaren statistischen Informationen über die Empfänger.
Im vorliegenden Fall, in dem die Kunden des Unternehmens selten andere Steuerpflichtige sind, stellte der Generalanwalt fest, dass das EU-Recht die Verwendung von Schätzungen zur Ermittlung des Anteils der an Steuerpflichtige ausgestellten Rechnungen nicht verbietet, sofern diese Schätzungen die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit beachten.
In Anbetracht des Zwecks des Grundsatzes der steuerlichen Neutralität würde es gegen diesen verstoßen, wenn der Steuerpflichtige für die Mehrwertsteuer haftbar gemacht würde, die erstattet werden könnte. Wenn die Rechnungen einen überhöhten Mehrwertsteuerbetrag ausweisen, müssen die EU-Länder dem Aussteller daher die Möglichkeit geben, die Steuer zu berichtigen, sofern das Risiko eines Einnahmeausfalls gemäß diesem Grundsatz rechtzeitig beseitigt wurde.
Was den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anbelangt, so muss jede Schätzung, die zur Bestimmung der Zahl der an Steuerpflichtige ausgestellten Rechnungen verwendet wird, genau, zuverlässig und aktuell sein. Um die Verteidigungsrechte der Steuerpflichtigen zu wahren, muss ihnen außerdem eine faire Gelegenheit gegeben werden, ihren Standpunkt darzulegen, die Richtigkeit der Schätzung anzufechten und zu erläutern, warum sie angepasst werden sollte, ohne dabei unangemessen hohe Beweisanforderungen zu stellen.
Endgültige Entscheidung des Gerichts
Letztlich entschied der EuGH, dass ein Steuerpflichtiger, der eine Rechnung mit einem falsch berechneten Mehrwertsteuersatz ausstellt, nicht für die zu Unrecht in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer haftet, wenn der Empfänger ein Nichtsteuerpflichtiger ist, selbst wenn der Leistungserbringer ähnliche Leistungen auch an andere Steuerpflichtige erbringt.
Was die Auslegung des Begriffs "Endverbraucher, die kein Recht auf Vorsteuerabzug haben" betrifft, so hat der EuGH in seiner früheren Rechtsprechung klargestellt, dass dieser Begriff ausschließlich für Nichtsteuerpflichtige gilt. Folglich sind Steuerpflichtige, die in bestimmten Situationen kein Recht auf Vorsteuerabzug haben, von der Definition ausgeschlossen.
Schließlich hindert die vereinfachte Rechnungsstellung nach Artikel 238 die Steuerbehörden oder nationalen Gerichte nicht daran, anhand von Schätzungen zu ermitteln, welche Rechnungen die Mehrwertsteuerschuld nach Artikel 203 begründen. Dabei müssen die Steuerbehörden oder die nationalen Gerichte jedoch alle relevanten Umstände berücksichtigen, und die Steuerpflichtigen müssen die Möglichkeit haben, die Ergebnisse gemäß den Grundsätzen der steuerlichen Neutralität, der Verhältnismäßigkeit und der Verteidigungsrechte anzufechten.
Schlussfolgerung
Letztlich hat der EuGH bekräftigt, dass die Mehrwertsteuerpflicht nur dann entsteht, wenn ein tatsächliches Risiko eines Steuerausfalls besteht, was der Fall ist, wenn ein Empfänger zu Unrecht einen Vorsteuerabzug geltend machen könnte. Darüber hinaus ließ der EuGH die Verwendung angemessener Schätzungen zur Ermittlung der potenziellen Mehrwertsteuerschuld im Rahmen der vereinfachten Rechnungsstellung zu, sofern mehrere wichtige Grundsätze beachtet werden.
Quelle: Rechtssache C-794/23 - Finanzamt, Österreich gegen P GmbH, EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, EuGH Rechtssache C-378/21 - P GmbH gegen Finanzamt, Österreich

Ausgewählte Einblicke
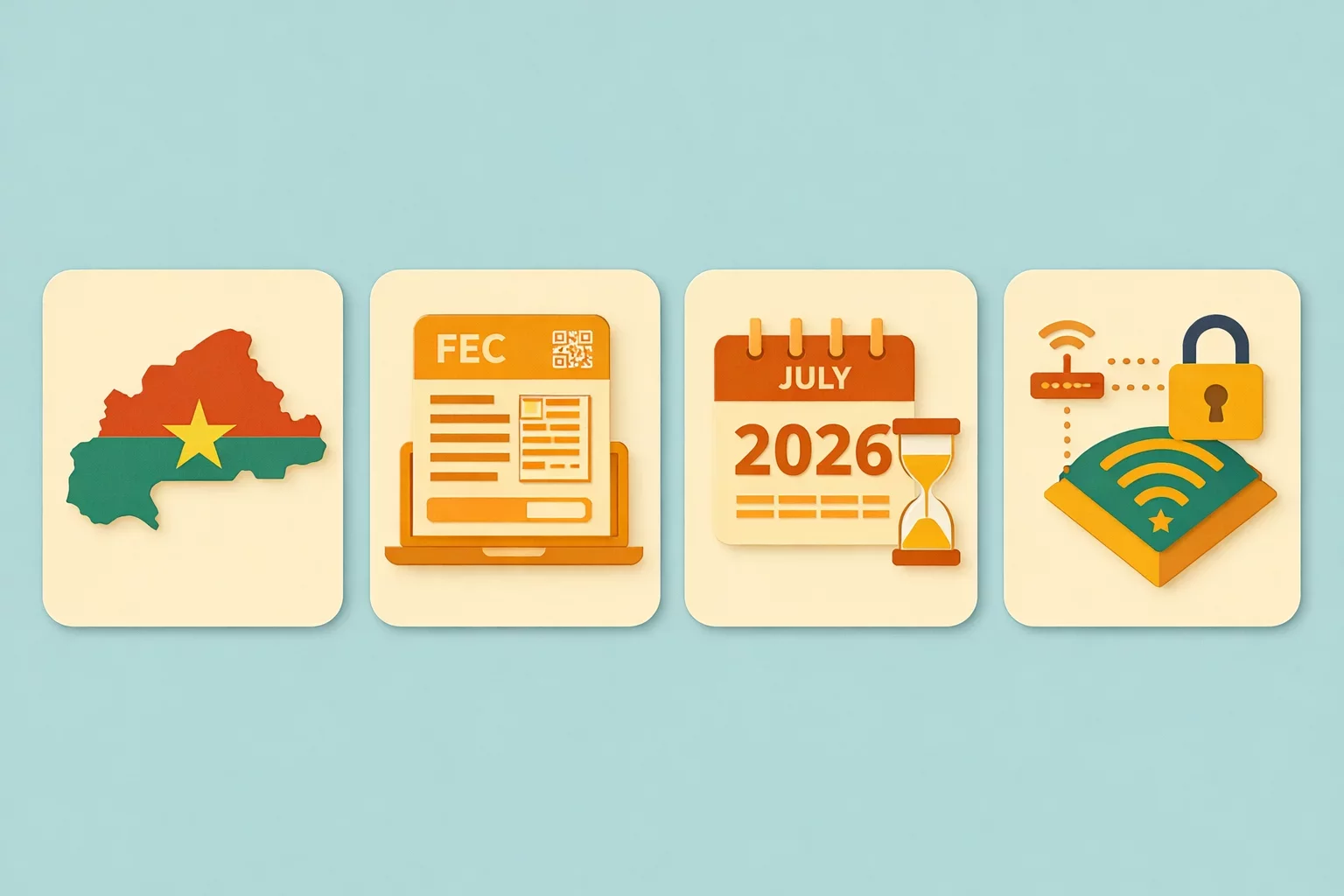
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
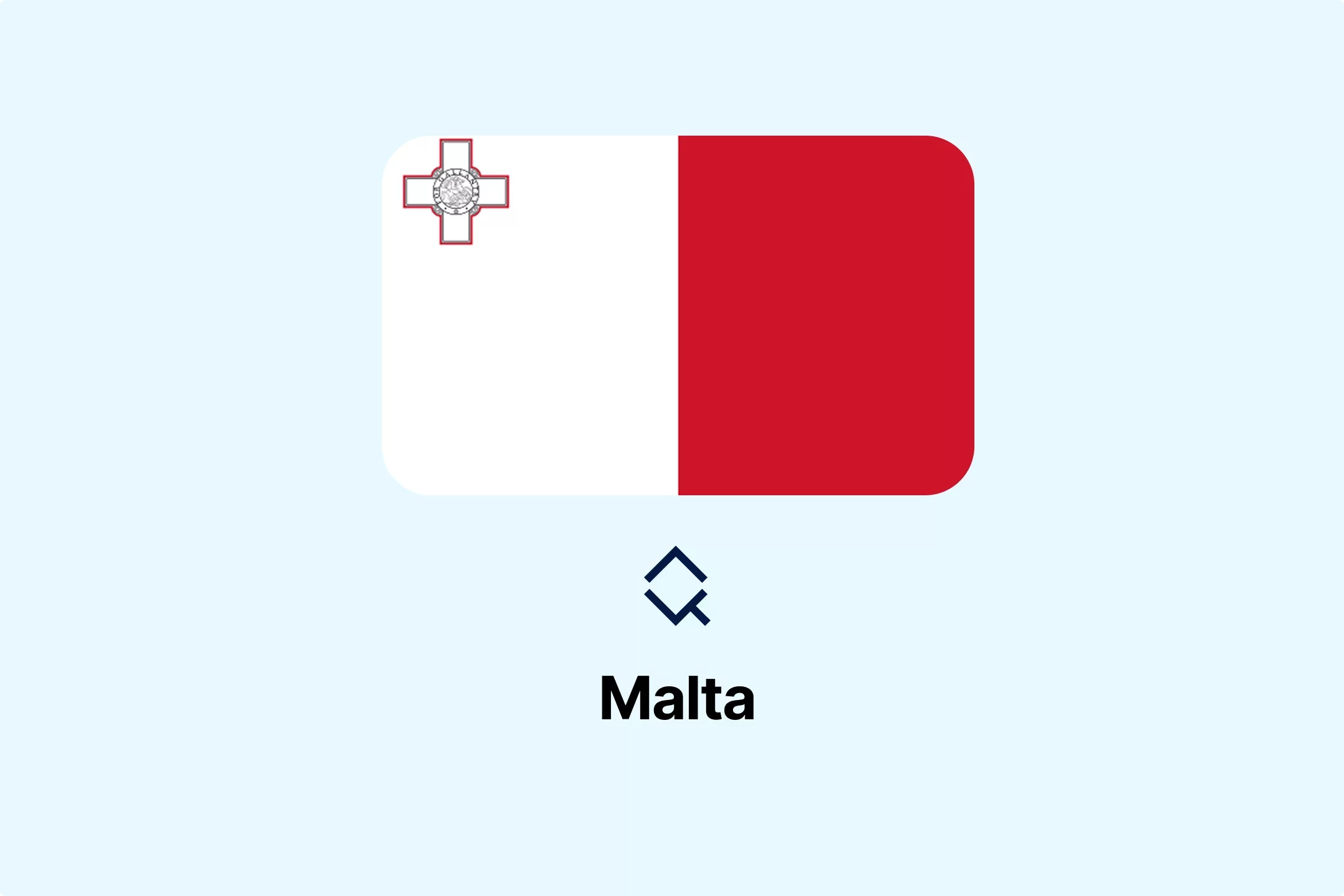
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
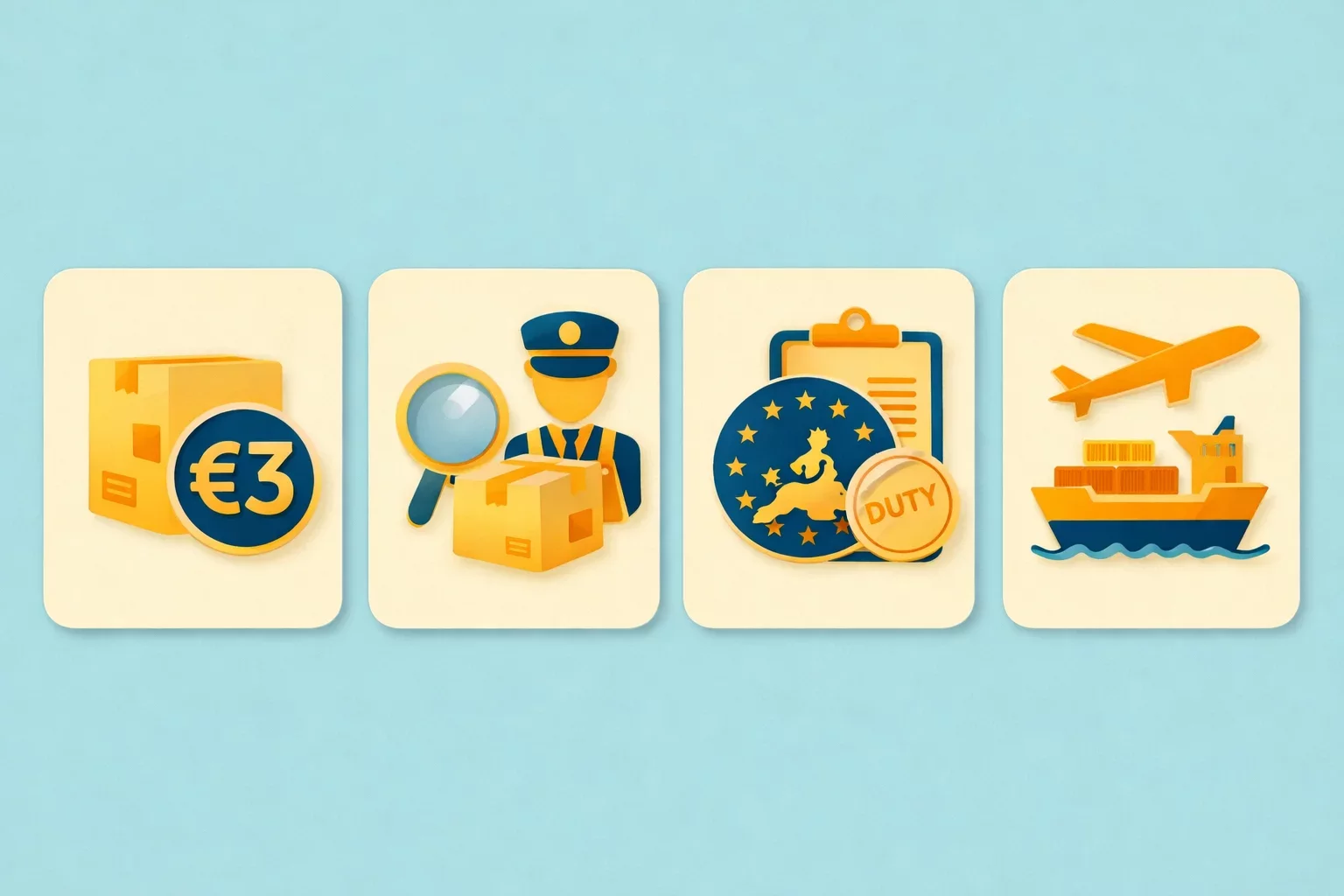


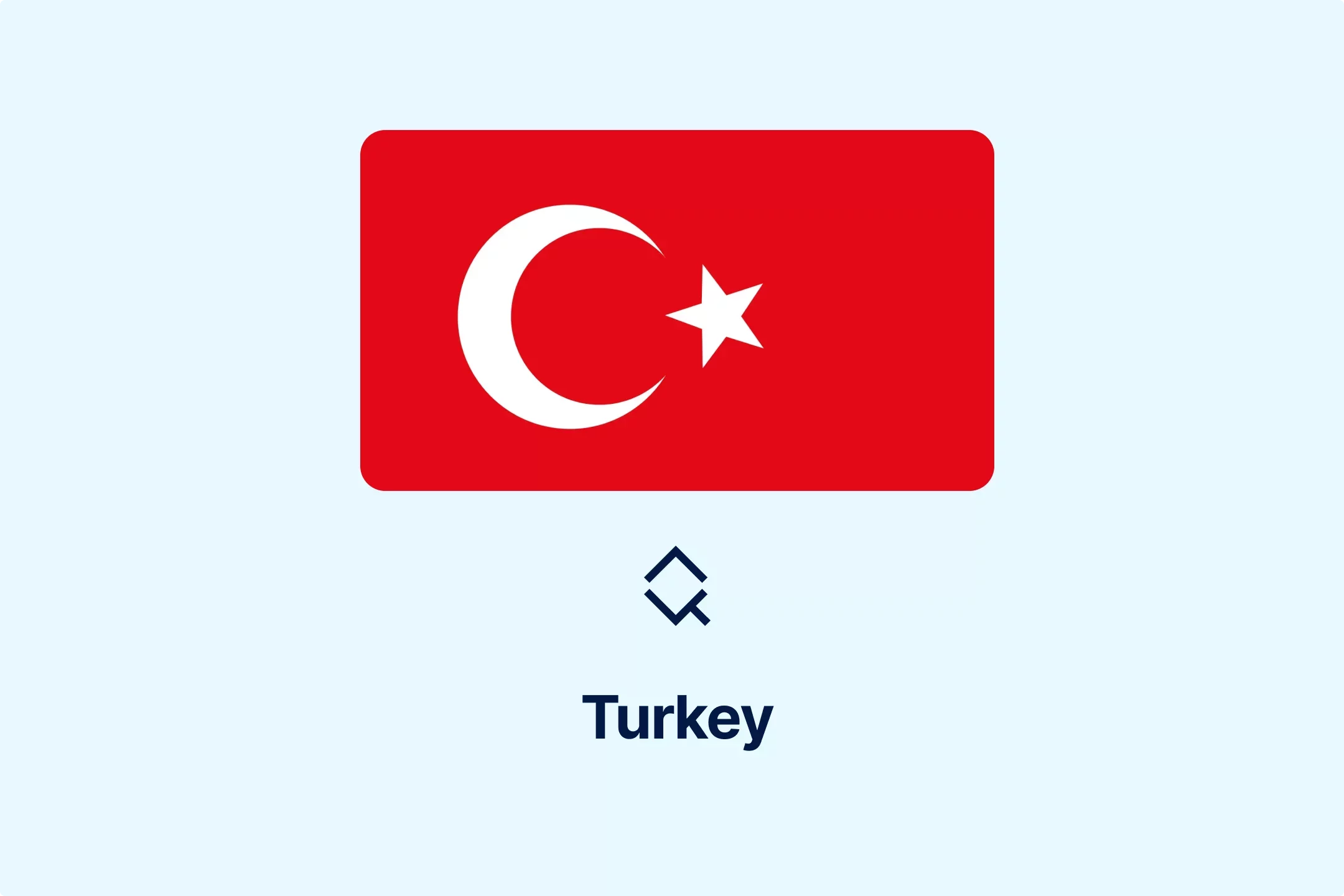




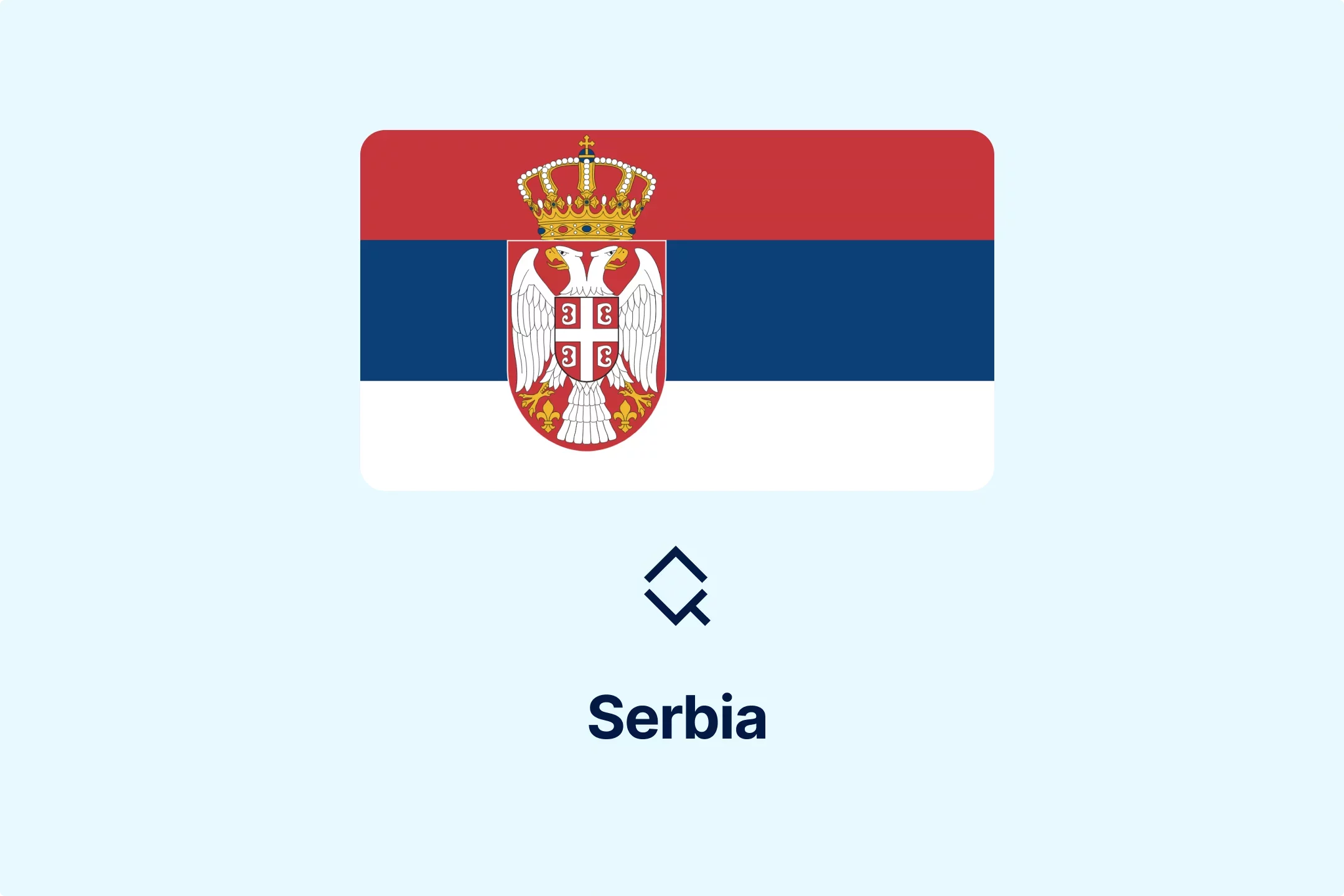
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



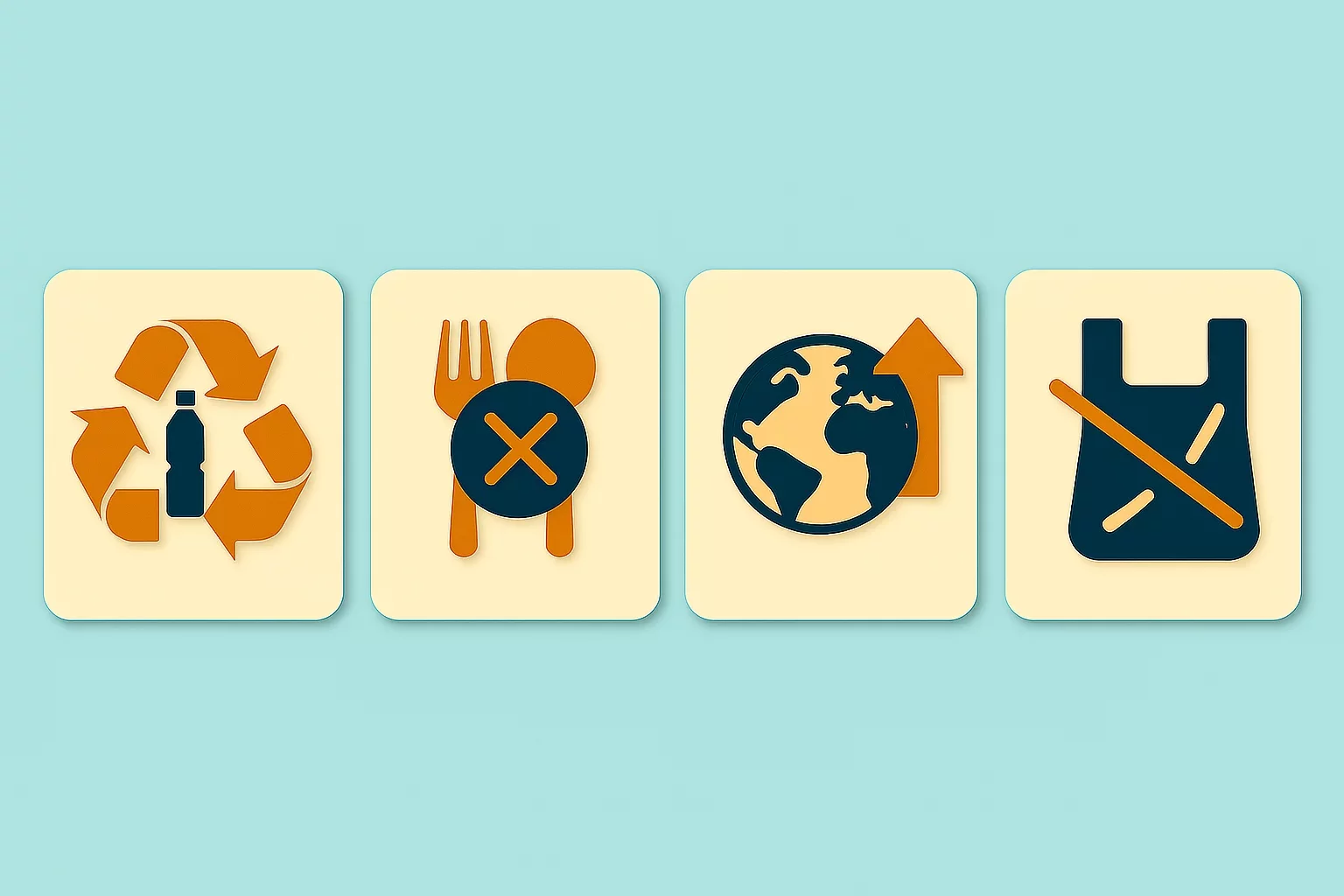


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
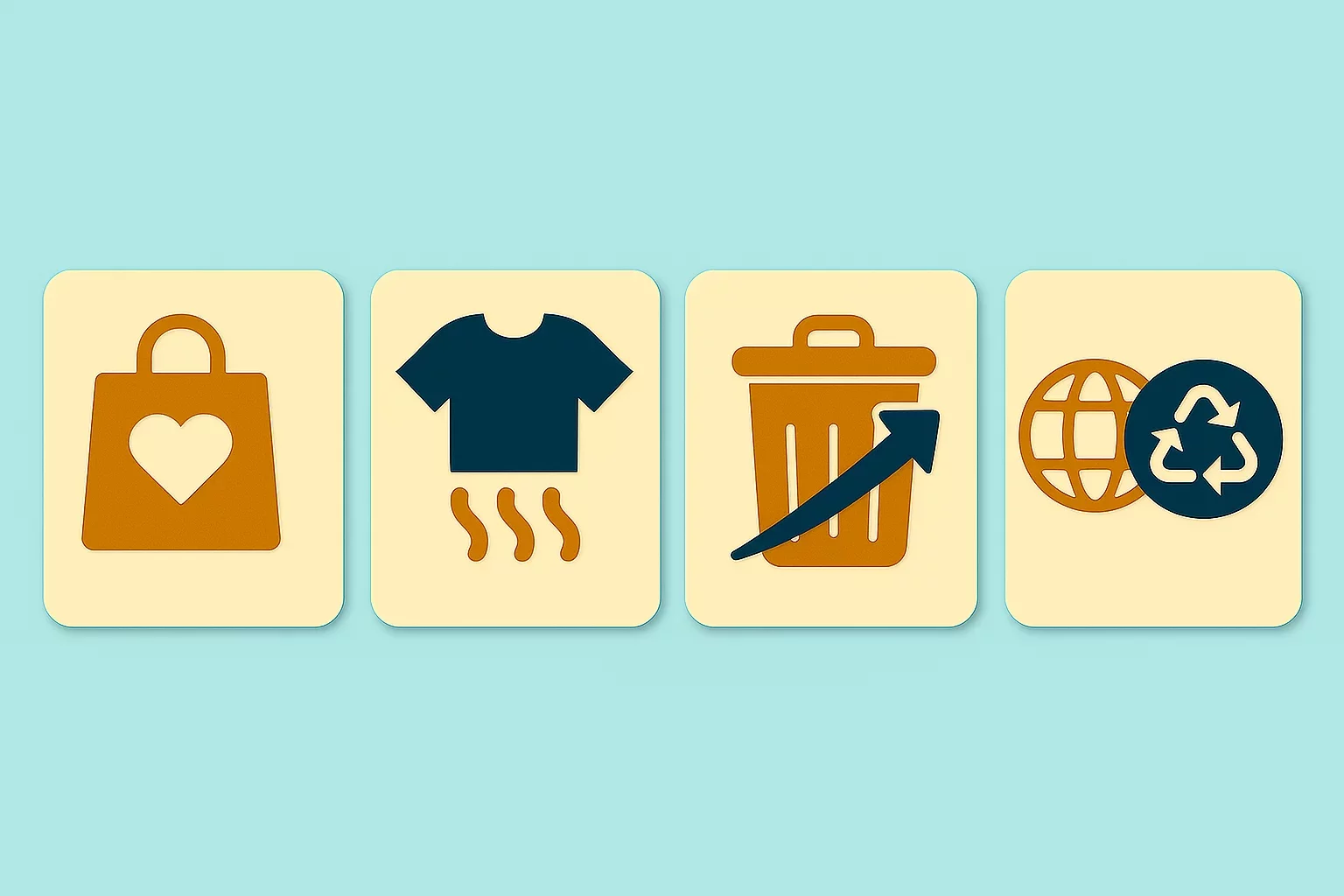

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
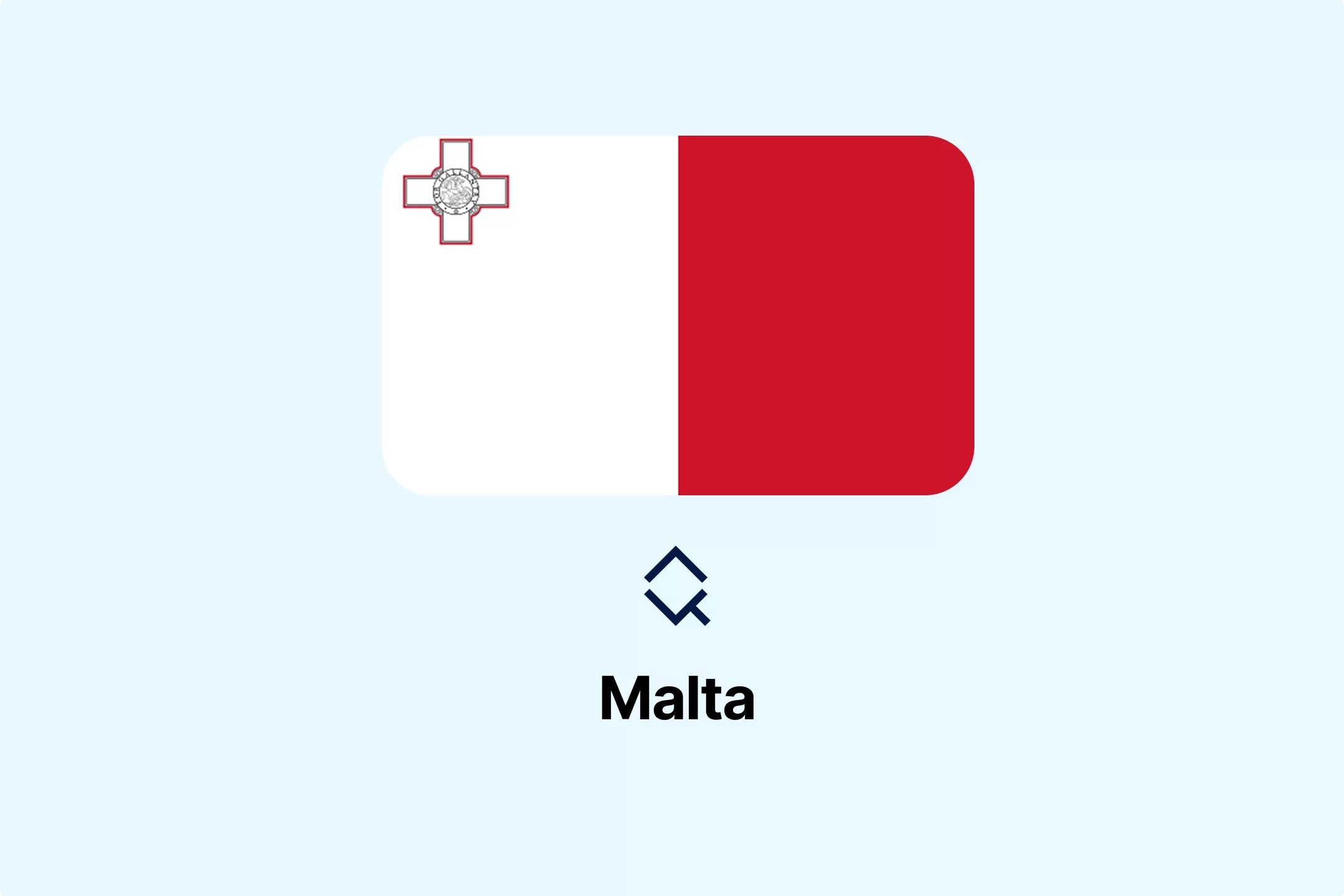
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
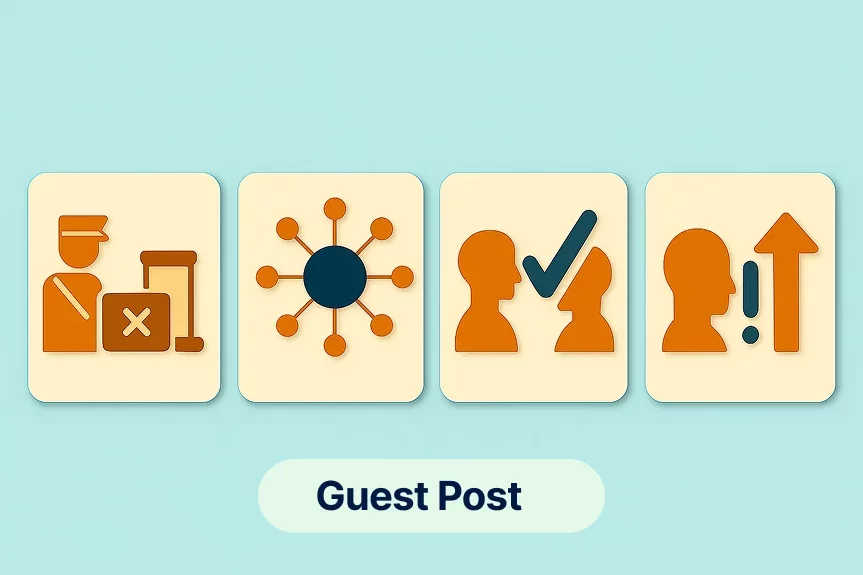

-hafis0ii23.webp)
-qseaw5zmcy.webp)


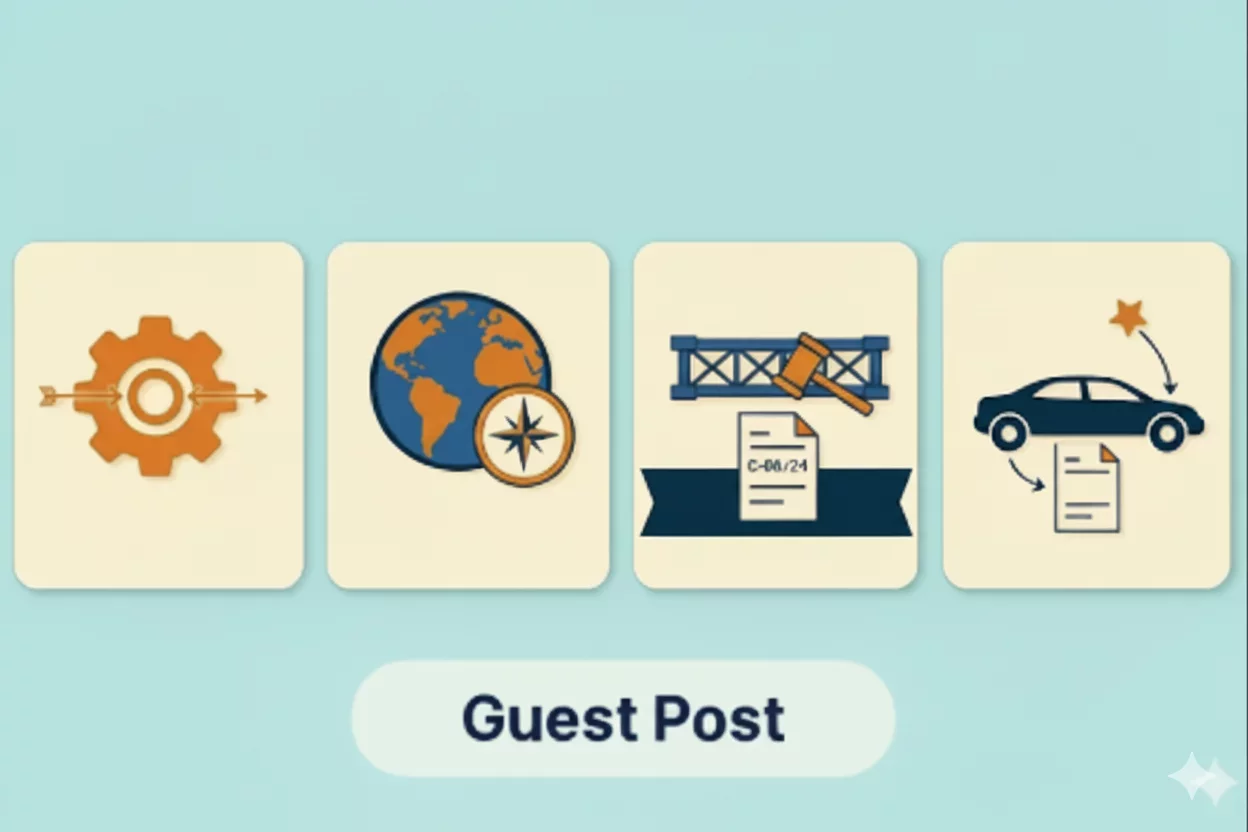
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



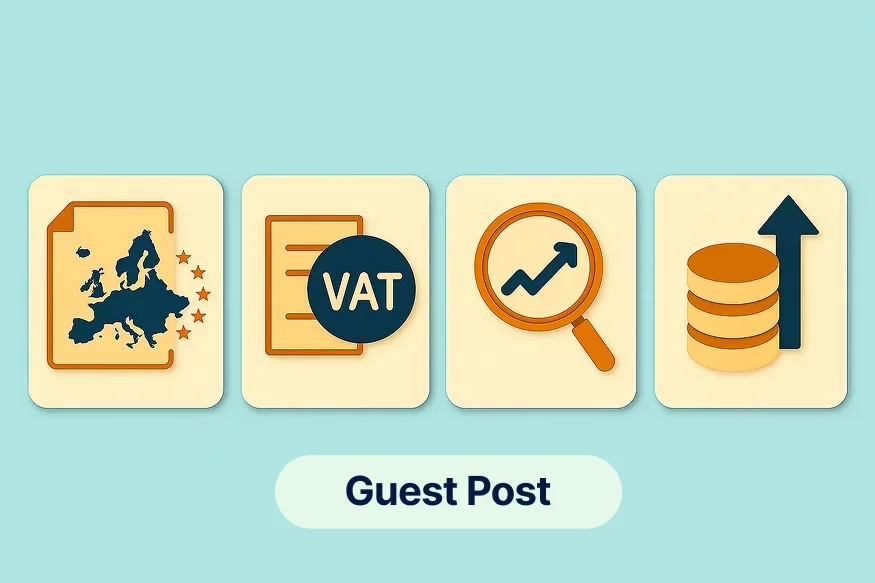
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

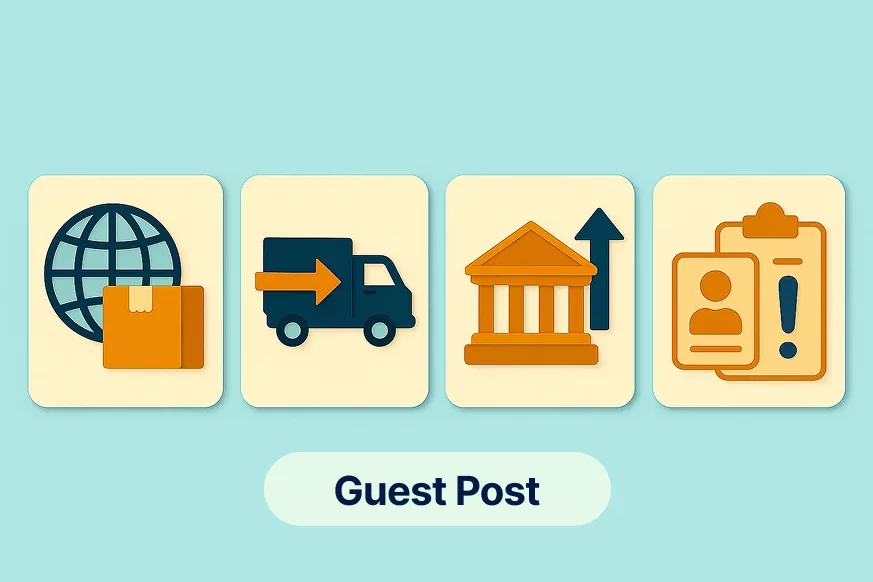
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
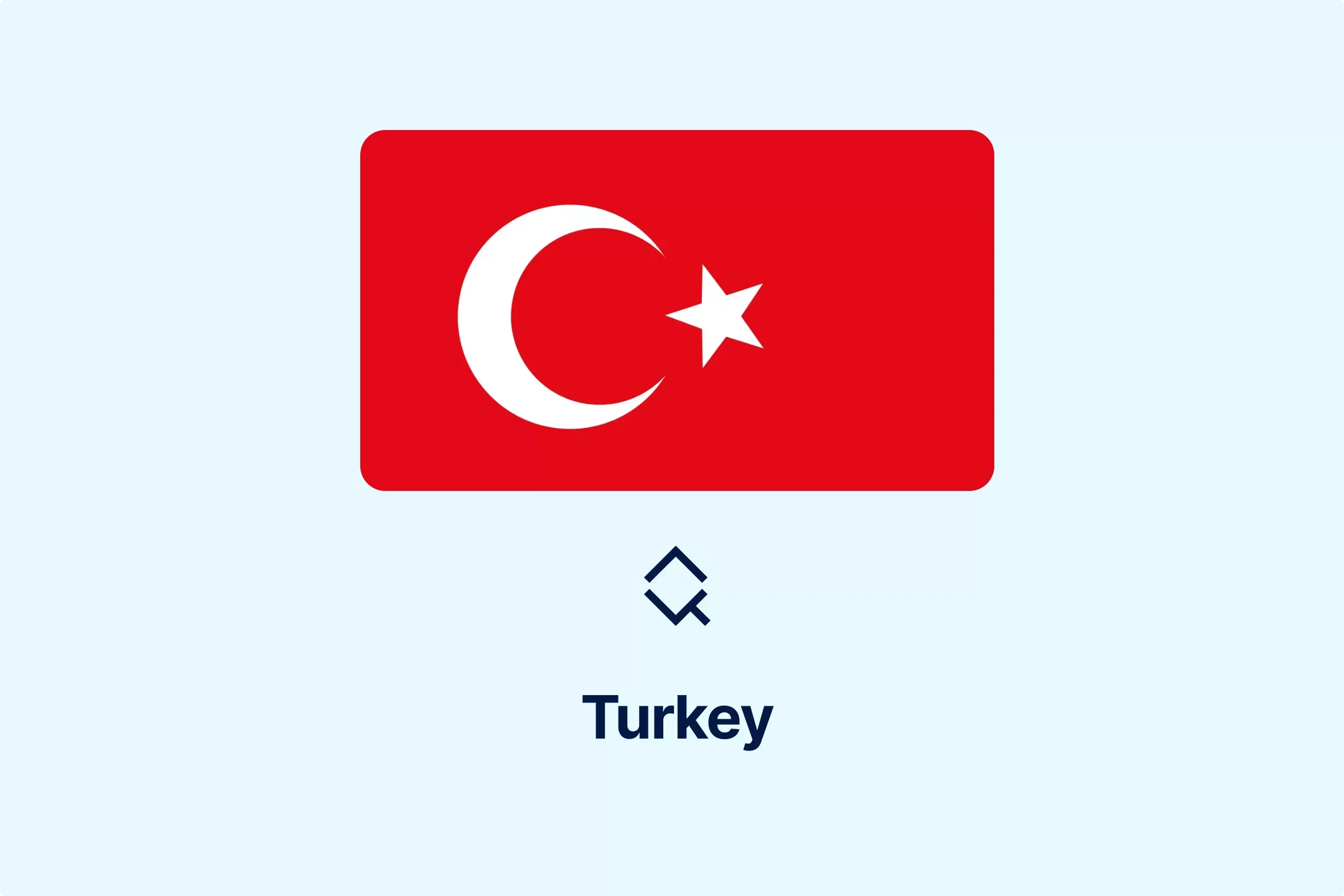
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)








-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

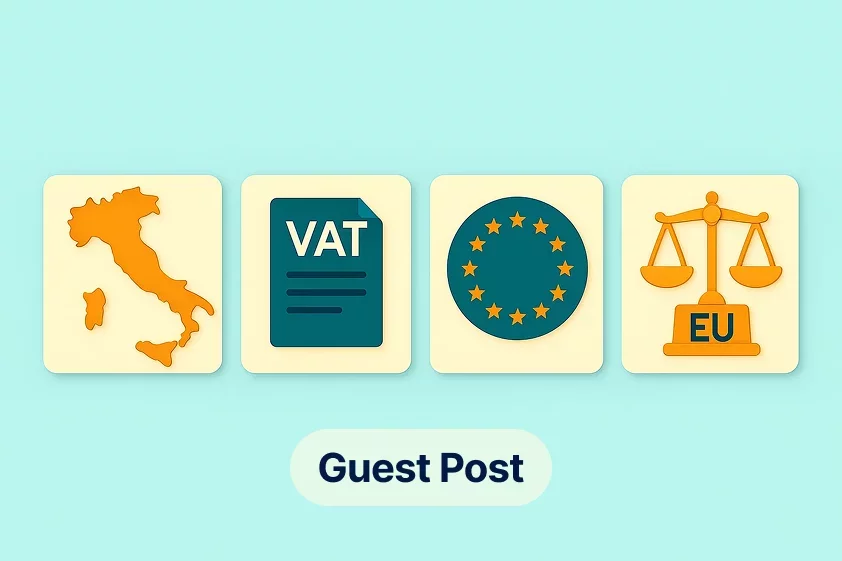

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





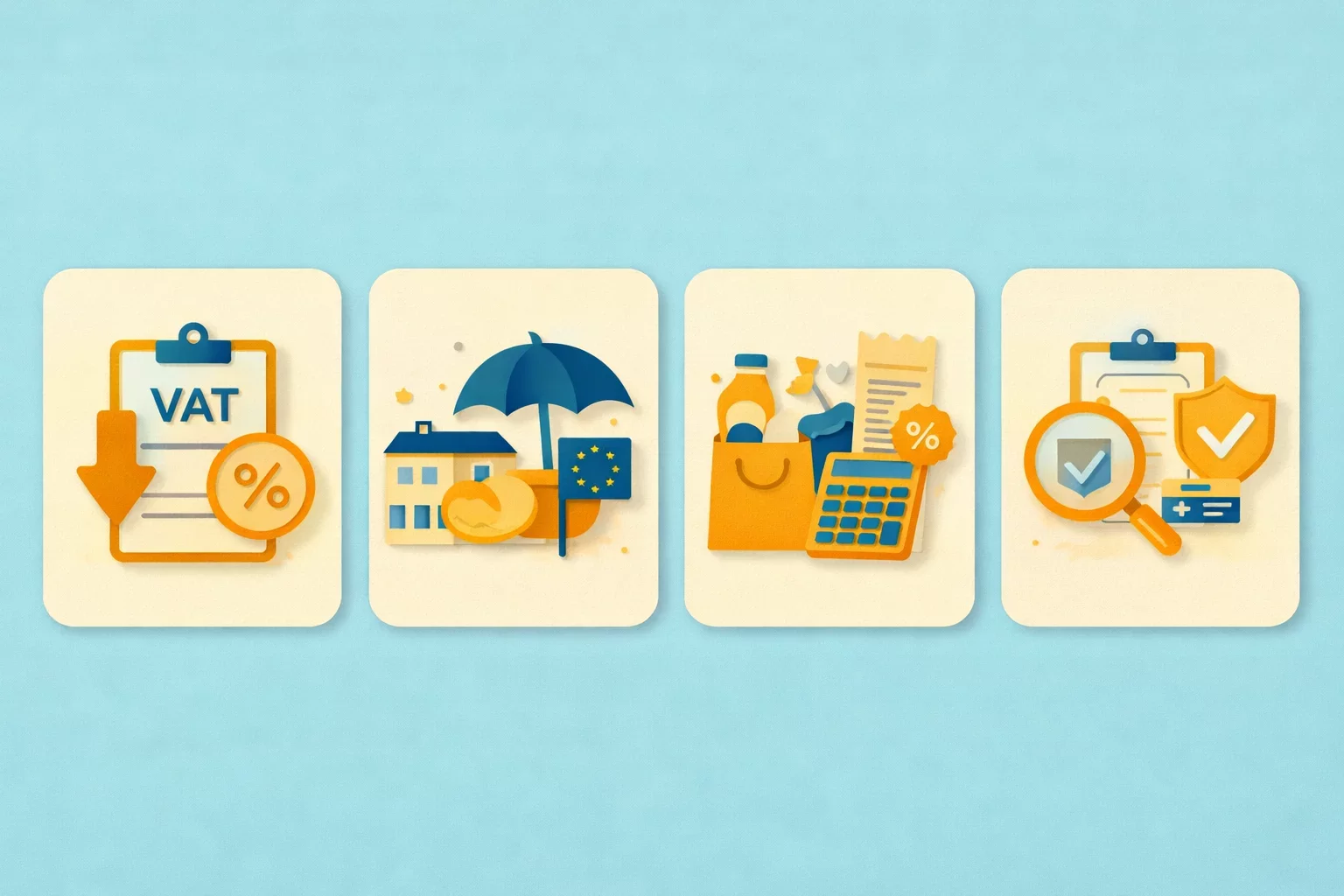
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)




-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)




































































































































