Zu Unrecht erhobene Zölle: EuGH klärt EU-Regeln

Der Streit zwischen andorranischen Importeuren und der französischen Zollbehörde über Zölle auf Waren, die zwischen 1988 und 1991 nach Andorra eingeführt wurden, mag wie ein Relikt aus der Vergangenheit erscheinen. Dennoch hat er tiefgreifende Auswirkungen auf das EU-Recht und die Rechte der Steuerpflichtigen von heute.
Im Mittelpunkt dieses Falles steht die Frage, wann und wie die nationalen Zollbehörden tätig werden müssen, um zu Unrecht erhobene Abgaben zu erstatten, und ob verfahrenstechnische oder verwaltungstechnische Hürden Verzögerungen bei der Erstattung oder Nicht-Erstattung rechtfertigen können. Neben dieser Frage verdeutlicht der Fall auch grundlegende Prinzipien des EU-Zollrechts und die Anforderungen an die nationalen Zollbehörden, proaktiv zu handeln, um den Schutz der den Steuerpflichtigen durch die EU-Rechtsvorschriften gewährten Rechte zu gewährleisten.
Hintergrund des Falles
Zwischen 1988 und 1991 führten in Andorra registrierte Unternehmen über Ysal, einen in Frankreich ansässigen Zollagenten, Waren aus Drittländern nach Andorra ein. Die eingeführten Waren lösten in Frankreich die Zahlung von Zöllen aus, da die französischen Zollbehörden verlangten, dass diese Waren bei der Einfuhr nach Frankreich in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden, obwohl sie für Andorra bestimmt waren.
Die Europäische Kommission sah in dieser Praxis einen Verstoß gegen die EU-Vorschriften und -Verordnungen und gab im Januar 1991 eine Stellungnahme ab, in der sie feststellte, dass Frankreich gegen EU-Recht verstößt, und Frankreich aufforderte, seine Praxis innerhalb von 30 Tagen zu ändern. Im März 1991 teilte die französische Regierung der Europäischen Kommission mit, dass sie der Aufforderung nachkommen und die beanstandete Vorschrift abschaffen würde, was durch eine im Juni 1991 im französischen Amtsblatt veröffentlichte Mitteilung bestätigt wurde.
Im Jahr 2008 reichte Ysal vor dem französischen Gericht erster Instanz eine Klage gegen die Zollverwaltung ein und forderte die Rückzahlung von Zöllen, die zwischen 1988 und 1991 zu Unrecht auf Einfuhren nach Andorra erhoben worden waren. Das Gericht wies diese Ansprüche jedoch 2010 mit der Begründung ab, dass Ysal weder die Klagebefugnis noch das Interesse an der Verfolgung der Angelegenheit habe.
Diese Entscheidung wurde 2011 bestätigt und führte zu einer Berufung vor dem Kassationsgerichtshof, der das Urteil 2014 ebenfalls bestätigte. Der Kassationsgerichtshof stellte fest, dass Ysal die Zölle lediglich im Namen der andorranischen Importeure gezahlt hatte, die Ysal bereits erstattet hatten, so dass nur die Importeure selbst das Recht hatten, die Rückzahlung zu fordern.
Daher erhoben die andorranischen Importeure, deren Rechte später auf Caves Andorranes und YX übergingen, im Jahr 2015 Klage vor dem Landgericht Toulouse auf Erstattung der von ihnen gezahlten Zölle. Diese Klagen wurden jedoch im Jahr 2017 abgewiesen, und das Berufungsgericht Toulouse bestätigte diese Entscheidung im Jahr 2020.
Der Hauptgrund für diese Entscheidung war die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts Toulouse, dass die französischen Zollbehörden für die Erstattung der strittigen Zölle auf der Grundlage der Verordnung Nr. 1430/79 und des Zollkodex der Gemeinschaften ausreichende Informationen benötigen, um sowohl den genauen Betrag der Zölle als auch die Identität jedes Zollschuldners festzustellen, ohne unverhältnismäßige Ermittlungen anstellen zu müssen.
Sowohl Caves Andorranes als auch YX legten gegen diese Entscheidung Berufung beim Kassationsgerichtshof ein und machten geltend, dass das Berufungsgericht das EU-Recht falsch angewandt habe und dass Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1430/79 nur eine Frist von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Abgaben vorschreibe und nicht verlange, dass den Zollbehörden die geschuldeten Beträge oder die Identität der Beteiligten vorher bekannt seien.
Nach Prüfung des Vorbringens aller Beteiligten war sich der Kassationsgerichtshof nicht sicher, ob es den Zollbehörden untersagt ist, nach Ablauf der Dreijahresfrist von sich aus Erstattungen vorzunehmen, selbst wenn innerhalb dieses Zeitraums die Rechtswidrigkeit der Abgaben festgestellt wurde. Daher hat der Kassationsgerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Hauptfragen aus dem Ersuchen um Vorabentscheidung
Der Kassationsgerichtshof legte dem EuGH zwei Fragen vor. Mit seiner ersten Frage möchte der Kassationsgerichtshof wissen, ob die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1430/79 und des Zollkodex der Gemeinschaften so zu verstehen sind, dass sie die Erstattung von zu Unrecht erhobenen Zöllen durch die Behörden von Amts wegen auf drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Erhebung der Zölle beschränken, oder ob sie stattdessen verlangen, dass die Behörden innerhalb dieser drei Jahre nachweisen, dass die Zölle nicht rechtmäßig geschuldet waren.
Die zweite Frage lautet, ob eine solche Erstattung voraussetzt, dass die Zollbehörden bereits Kenntnis sowohl von der Identität der Betroffenen als auch von den genauen Beträgen haben, die jedem von ihnen zu erstatten sind, ohne dass sie verpflichtet sind, umfangreiche oder unverhältnismäßige Ermittlungen durchzuführen.
Anwendbarer EU-Richtlinienartikel
In diesem Fall hat der EuGH die Bestimmungen der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie nicht berücksichtigt und ausgelegt. Stattdessen wurden Bestimmungen der Verordnung Nr. 1430/79, in der die Regeln für die Erstattung oder den Erlass von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben festgelegt sind, sowie der Zollkodex der Gemeinschaft ausgelegt.
In Bezug auf die Verordnung Nr. 1430/79 wurden die Artikel 1, 2 und 15 Absatz 1 als die wichtigsten hervorgehoben. Der EuGH stellte insbesondere fest, dass diese Verordnung durch Artikel 251 des Zollkodex der Gemeinschaften aufgehoben wurde. Daher bezeichnete der EuGH Artikel 236 des Zollkodex der Gemeinschaften als denjenigen, in dem die Regeln für die Erstattung oder den Erlass von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben festgelegt sind.
In diesem Artikel heißt es, dass die Abgaben erstattet oder erlassen werden, wenn festgestellt wird, dass sie nicht rechtmäßig geschuldet werden oder falsch verbucht wurden, es sei denn, der Steuerpflichtige hat den Fehler vorsätzlich verursacht. Außerdem müssen diese Anträge innerhalb von drei Jahren nach Mitteilung der Abgaben an den Schuldner gestellt werden, wobei Verlängerungen bei unvorhersehbaren Umständen oder höherer Gewalt möglich sind.
Der Zollkodex der Gemeinschaft, der am 1. Januar 1994 in Kraft trat, wurde später aufgehoben und 2008 durch den Modernisierten Zollkodex ersetzt, der wiederum 2013 durch den Zollkodex der Union aufgehoben und ersetzt wurde.
Frankreich Nationale Vorschriften
Der EuGH hat in diesem Fall keine nationalen Mehrwertsteuer- oder Zollvorschriften berücksichtigt. Daher erging die Entscheidung ausschließlich durch Auslegung der EU-weiten Vorschriften zur Regelung von Zollangelegenheiten, die auf den vorliegenden Fall anwendbar sind.
Bedeutung des Falles für Steuerpflichtige
In Anbetracht der Tatsache, dass der Hauptstreitpunkt die unrechtmäßige Erhebung und Zahlung von Zöllen ist, klärt der EuGH mit seiner Auslegung der anwendbaren Vorschriften und Verordnungen sowie mit seiner Entscheidung die Rechte der Steuerpflichtigen auf Erstattung von Zöllen und die Pflichten der Zollbehörden nach EU-Recht.
Obwohl sich die Rechtssache auf Zölle bezieht, die zwischen 1988 und 1991 entrichtet wurden, ist sie auch im Jahr 2025 noch von entscheidender Bedeutung, da sie die wichtigsten Grundsätze dafür festlegt, wie die Zollbehörden Erstattungen nach EU-Recht behandeln müssen. Darüber hinaus bietet sie einen Rechtsrahmen, der die Rückforderung zu Unrecht erhobener Abgaben gewährleistet, selbst wenn diese erst lange nach ihrer Entrichtung erfolgen, was sowohl für Steuerpflichtige als auch für Behörden, die mit historischen, komplexen oder grenzüberschreitenden Vorgängen zu tun haben, von entscheidender Bedeutung ist.
Analyse der Feststellungen des Gerichtshofs
Eine der ersten Bemerkungen des EuGH war, dass angesichts des Zeitpunkts, zu dem der angebliche Erstattungsanspruch entstanden ist, nur die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1430/79 (Verordnung) relevant sind. Der EuGH stellte fest, dass die Erstattung von Zöllen nach der Verordnung auf zwei Arten erfolgen kann, die beide in Artikel 2 Absatz 2 definiert sind.
Die erste Möglichkeit sieht vor, dass die Erstattung gewährt wird, wenn innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Abgabenerhebung ein Antrag bei der Zollstelle gestellt wird. Außerdem sind die Zollbehörden verpflichtet, die Erstattung von sich aus vorzunehmen, wenn sie innerhalb dieser Frist feststellen, dass die Abgaben zu Unrecht erhoben wurden. Wenn die Behörden also feststellen, dass die Zölle nicht rechtmäßig geschuldet waren oder den rechtmäßigen Betrag überschritten haben, müssen sie die Erstattung automatisch und ohne Aufforderung durch den Einführer vornehmen.
Hinsichtlich der fraglichen Dreijahresfrist stellte der EuGH fest, dass sie sich auf einen Zeitrahmen bezieht, innerhalb dessen die nationale Zollbehörde die Fälligkeit der Erstattung feststellen muss. Die tatsächliche Erstattung muss jedoch nicht innerhalb dieses Zeitraums erfolgen, sondern kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Darüber hinaus stellte der EuGH fest, dass, wenn Zölle auf der Grundlage bestimmter, von einem bestimmten Steuerpflichtigen angemeldeter Beträge erhoben werden, die nationalen Zollbehörden, die feststellen, dass diese Zölle zu Unrecht erhoben wurden, automatisch wissen, wer sie entrichtet hat und wie viel genau er bezahlt hat.
Die Zollbehörden können das Fehlen aufbewahrter Anmeldungen oder früherer Entscheidungen nicht als Entschuldigung dafür anführen, dass sie zu Unrecht erhobene Abgaben nicht innerhalb von drei Jahren zurückzahlen. Darüber hinaus sind die Zollbehörden verpflichtet, alle für die Erstattung relevanten Unterlagen aufzubewahren, auch dann, wenn die unrechtmäßige Erhebung auf einen Irrtum der Behörde in Bezug auf Zölle auf Einfuhren aus oder in ein Drittland zurückzuführen ist.
Wichtig ist auch, dass die EU-Vorschriften und -Verordnungen es den Behörden nicht erlauben, praktische, administrative oder finanzielle Schwierigkeiten als Rechtfertigung für die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen anzuführen, selbst in einer Situation, in der viele Steuerpflichtige betroffen sind und deren Identifizierung erhebliche Anstrengungen erfordert.
Selbst in Fällen, in denen die nationalen Zollbehörden Informationen benötigen, über die sie noch nicht verfügen, um die Erstattung zu erleichtern, wie z. B. die Identität eines Nachfolgers der Person, die die Abgaben ursprünglich entrichtet hat, oder die Angaben zu einem Bankkonto, hat dies keine Auswirkungen auf das Bestehen der Erstattungspflicht. Diese Informationen sind nur relevant, um festzustellen, ob die Zollbehörde gegen ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen oder vollständigen Erstattung und zum Tätigwerden auf eigene Initiative verstoßen hat.
Insbesondere in Fällen, in denen die Zollbehörden ohne eigenes Verschulden nicht über die für eine Erstattung erforderlichen Informationen verfügen, müssen sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese Informationen zu beschaffen und ihrer Verpflichtung nachzukommen. Auch wenn diese Schritte keine unverhältnismäßigen Anstrengungen erfordern sollten, die über das hinausgehen, was von einer sorgfältigen Verwaltung vernünftigerweise erwartet werden kann, ist es nicht hinnehmbar, nichts zu tun, weil die Informationen fehlen. Außerdem verstößt das Nichtstun sowohl gegen die Rückzahlungsverpflichtung als auch gegen den allgemeinen unionsrechtlichen Grundsatz der guten Verwaltung.
Der EuGH überließ es dem Kassationsgerichtshof zu prüfen, ob die französischen Zollbehörden innerhalb von drei Jahren nach der Erfassung der Abgaben den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung beachtet und festgestellt hatten, dass die Abgaben zu Unrecht erhoben worden waren.
Dennoch gab der EuGH dem Kassationsgerichtshof Hinweise, was zu beachten ist und wie zu beurteilen ist, ob die Maßnahmen der französischen Behörden, vor allem als Reaktion auf die Stellungnahme der Europäischen Kommission, implizit darauf hindeuten, dass sie die unrechtmäßige Erhebung der Abgaben anerkannt haben. Somit wären sie verpflichtet gewesen, diese Abgaben von sich aus zurückzuerstatten, da die Abgaben innerhalb der letzten drei Jahre erhoben worden waren.
Endgültige Entscheidung des Gerichts
Der EuGH kam zu dem Schluss, dass eine nationale Zollbehörde nur dann verpflichtet ist, Abgaben von sich aus zu erstatten, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach der Erfassung der Abgaben festgestellt hat, dass diese zu Unrecht erhoben wurden. Eine solche Feststellung setzt voraus, dass die Zollbehörde weiß, wer die Abgaben entrichtet hat und in welcher Höhe.
Angenommen, die Zollbehörden verfügen aus irgendeinem Grund nicht über alle erforderlichen Informationen, um dem ursprünglichen Einzahler oder seinen Rechtsnachfolgern die Abgaben zu erstatten, und könnten dies auch nicht tun. In diesem Fall müssen sie geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um diese Informationen zu erhalten, damit sie ihrer Erstattungspflicht nachkommen können.
Schlussfolgerung
Der EuGH kam nicht nur zu dem Schluss, dass die Zollbehörden zu Unrecht erhobene Zölle erstatten müssen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, sondern überließ es auch dem französischen Kassationsgerichtshof, festzustellen, ob die Zollbehörden die EU-Grundprinzipien beachtet haben und die Erstattung an die andorranischen Unternehmen zu Unrecht verweigert haben. Nichtsdestotrotz ist das Urteil eine wichtige Erinnerung daran, dass die Rechtmäßigkeit von Zöllen und die Rechte der Steuerpflichtigen für den Gesetzgeber und die Gerichte in der EU Priorität haben.
Quelle: Rechtssache C-206/24 - YX, Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA gegen Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt, Frankreich, und Generaldirektor für Zölle und indirekte Steuern, Frankreich, Verordnung Nr. 1430/79, Der Zollkodex der Gemeinschaften

Ausgewählte Einblicke
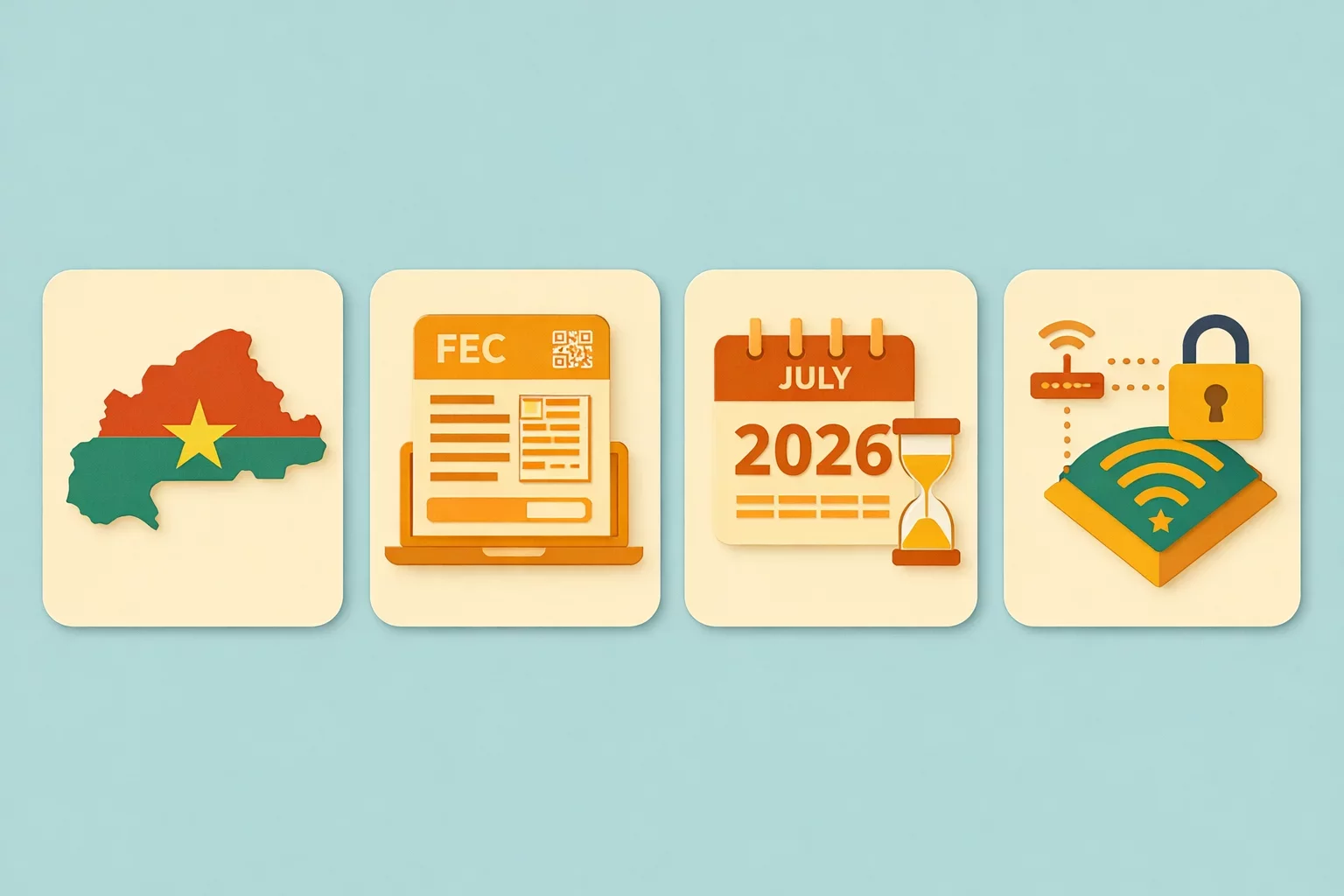
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)

-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
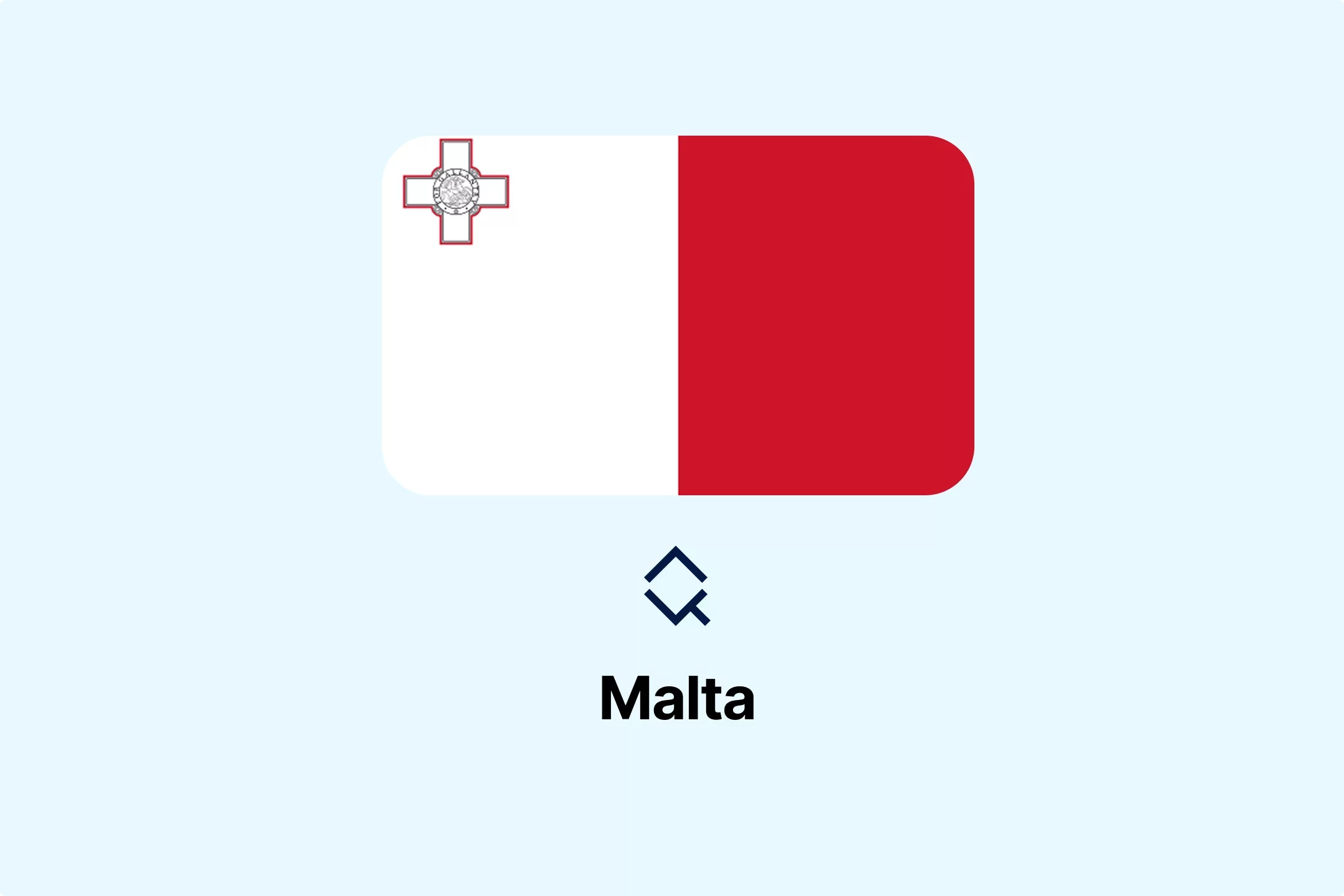
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
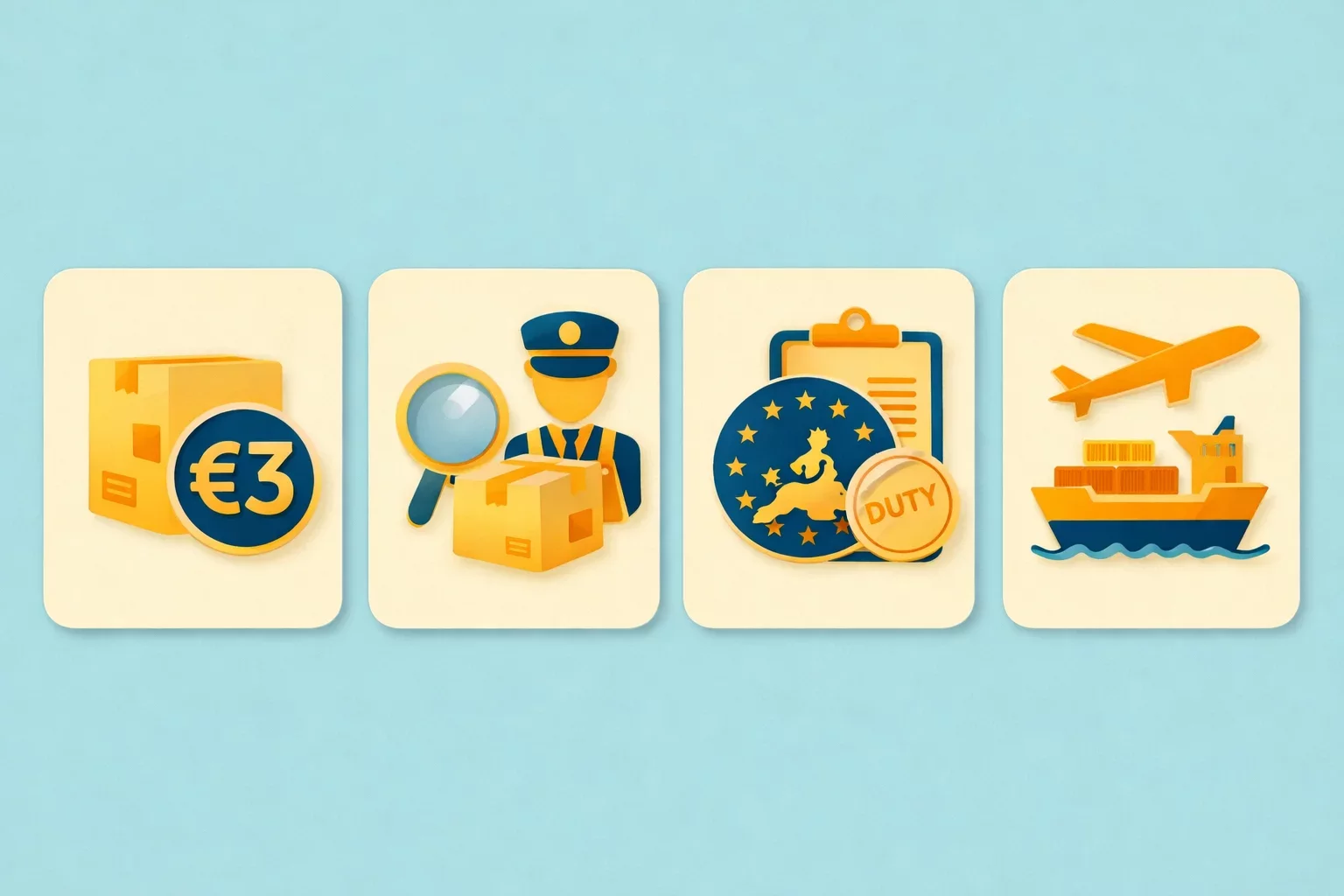


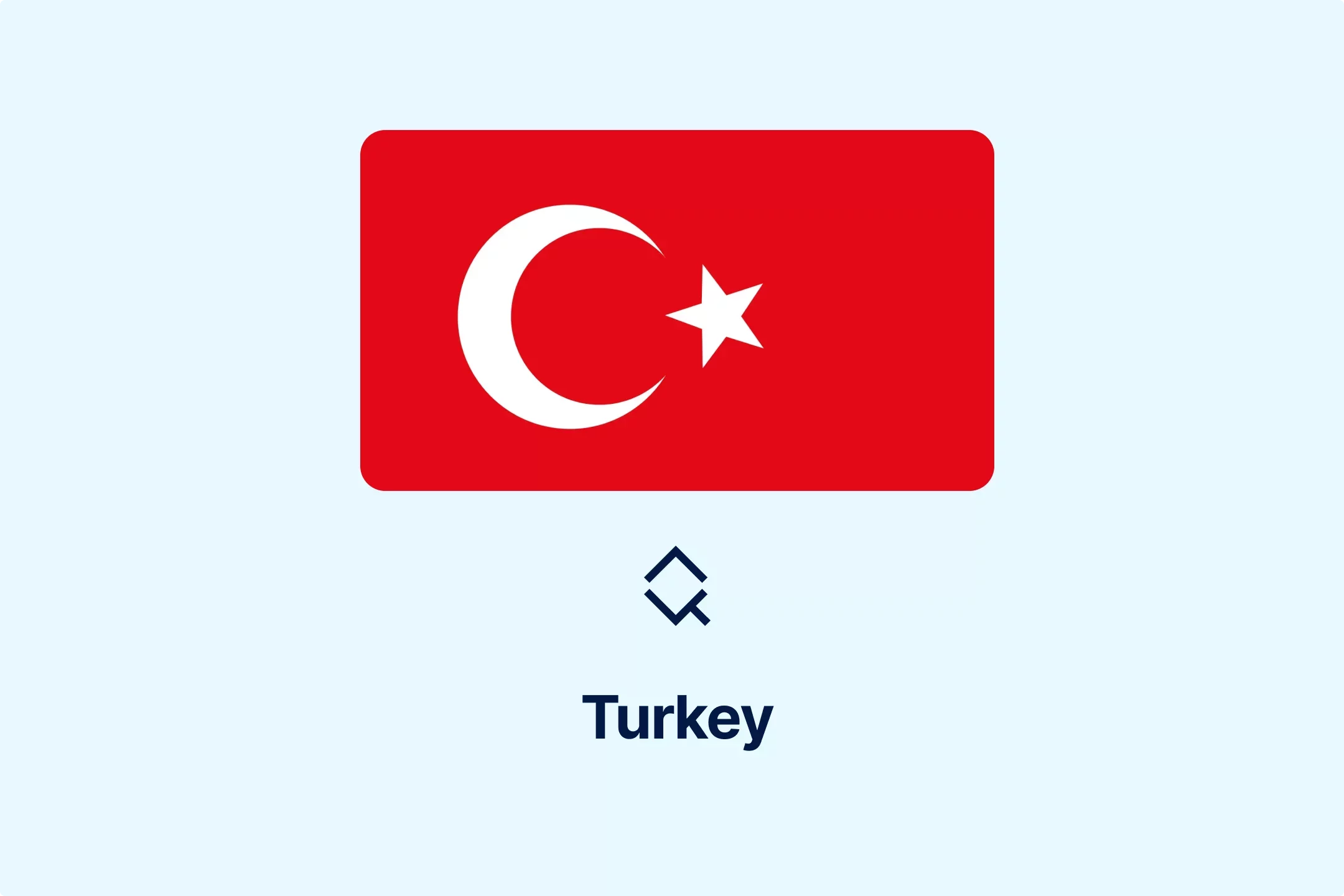




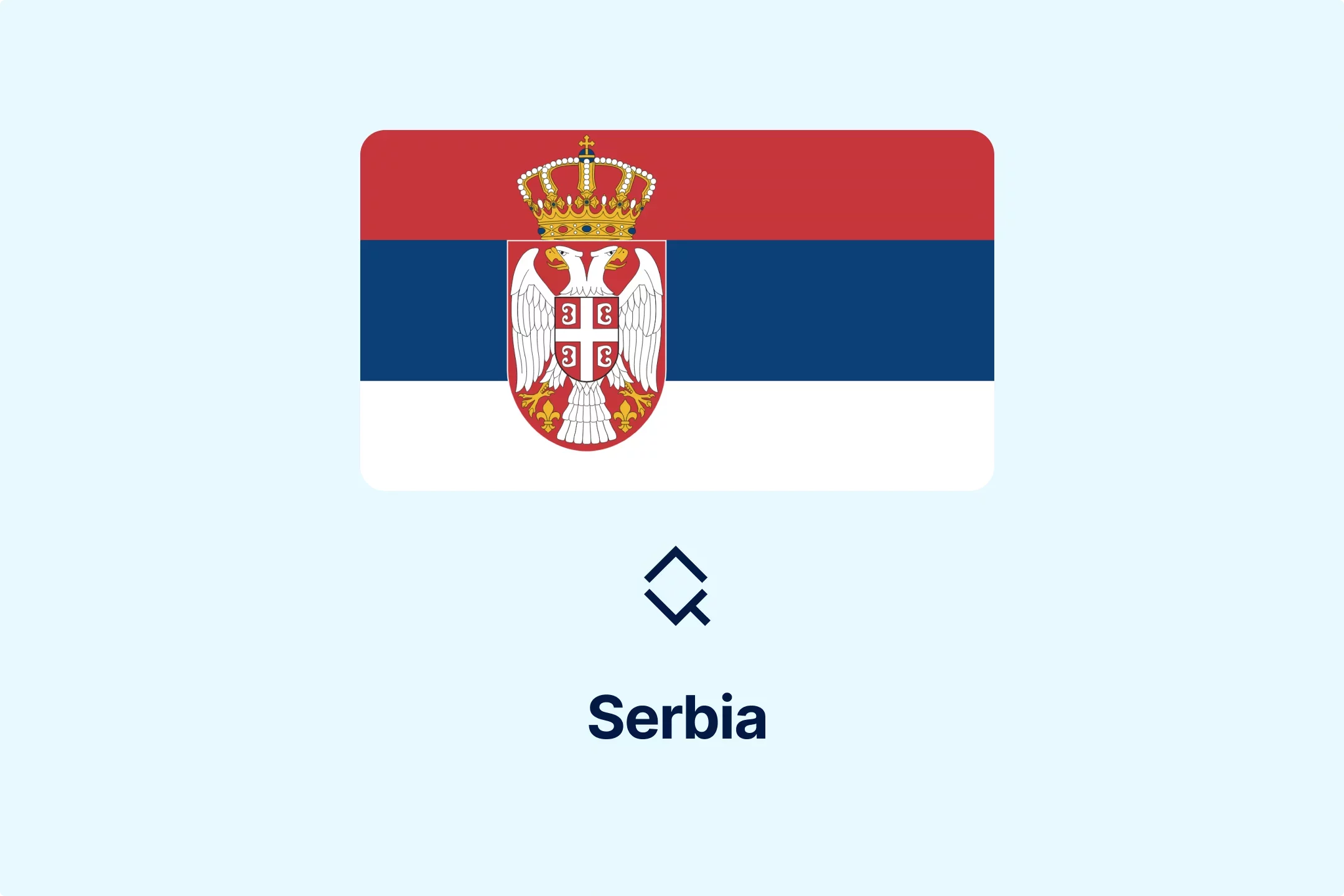
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



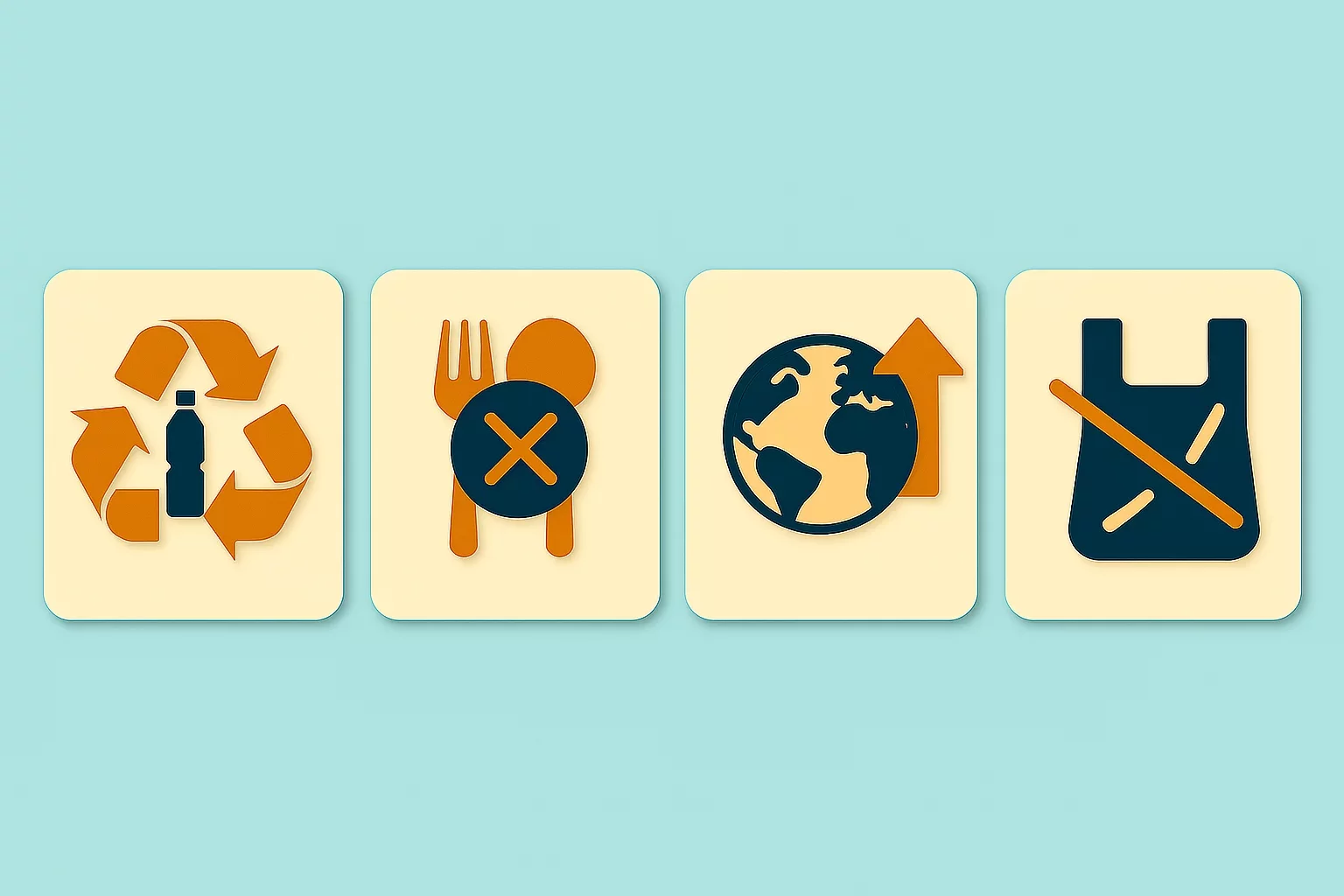


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
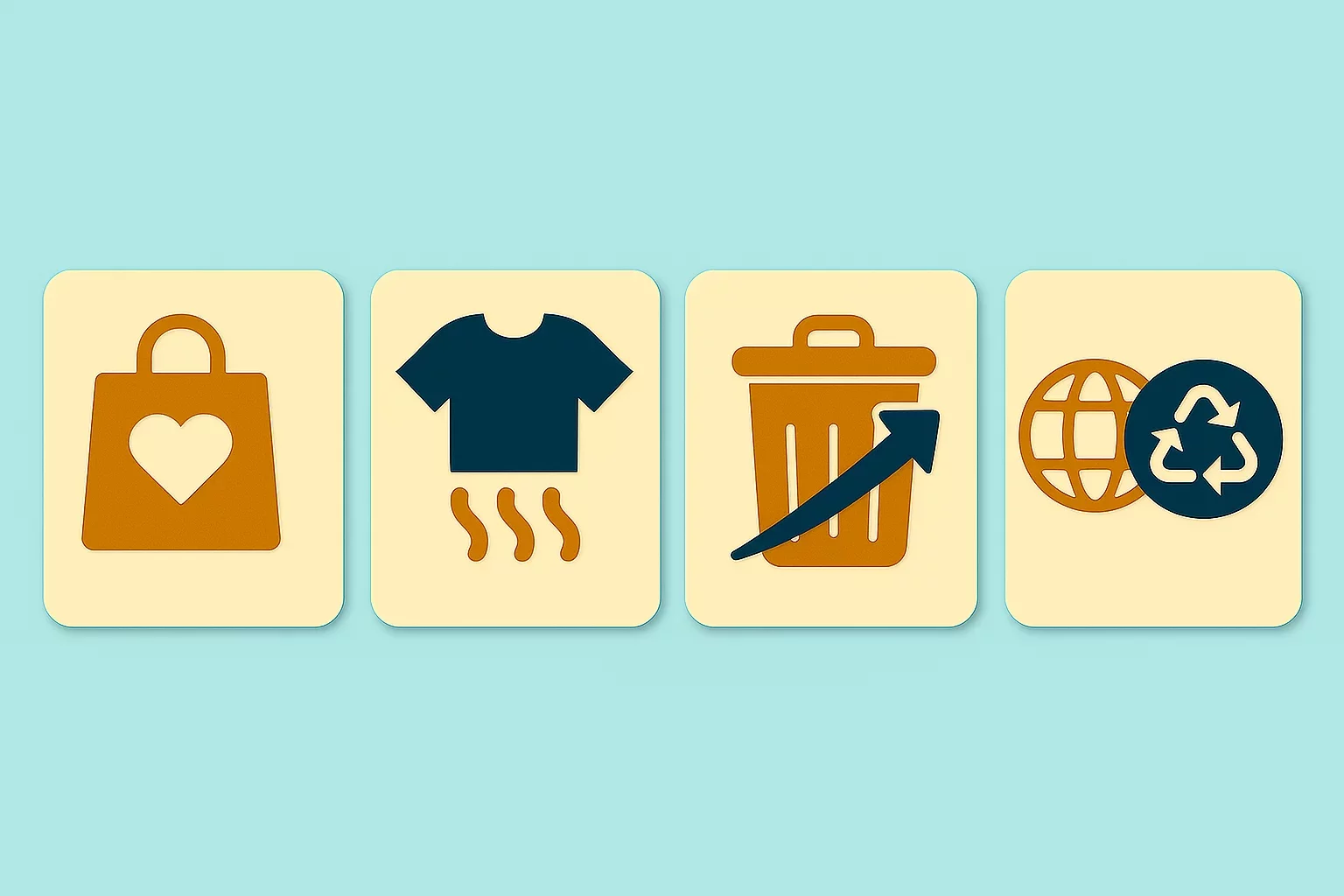

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
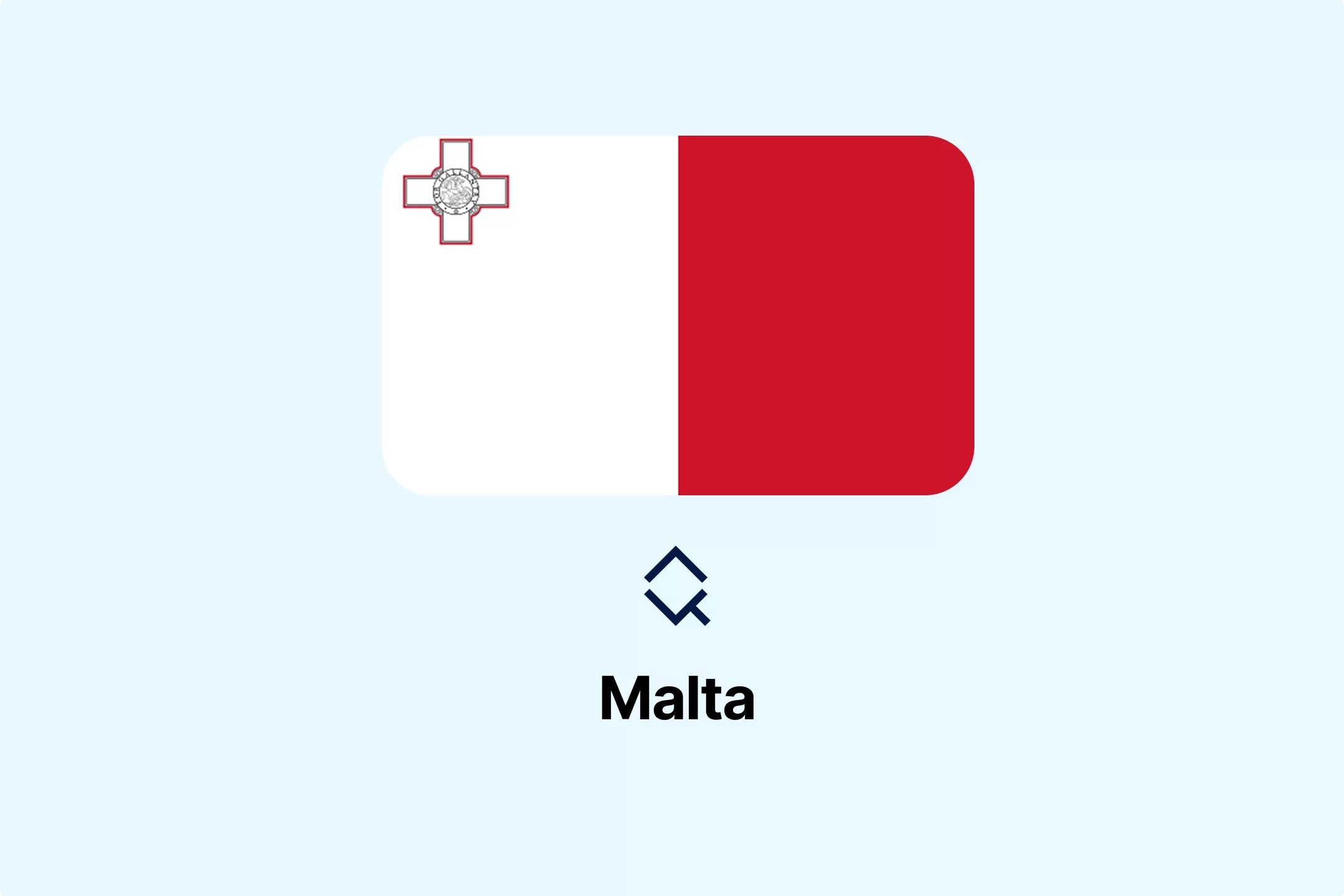
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
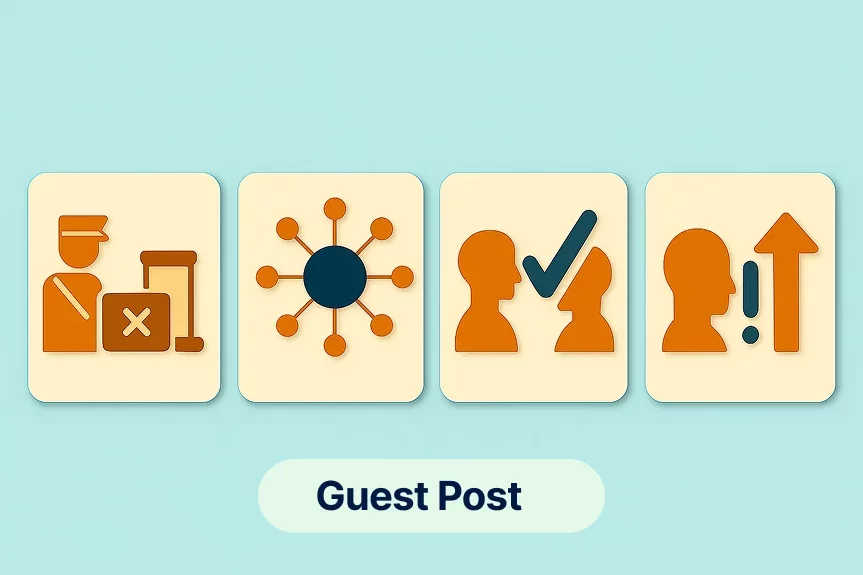

-hafis0ii23.webp)

-qseaw5zmcy.webp)


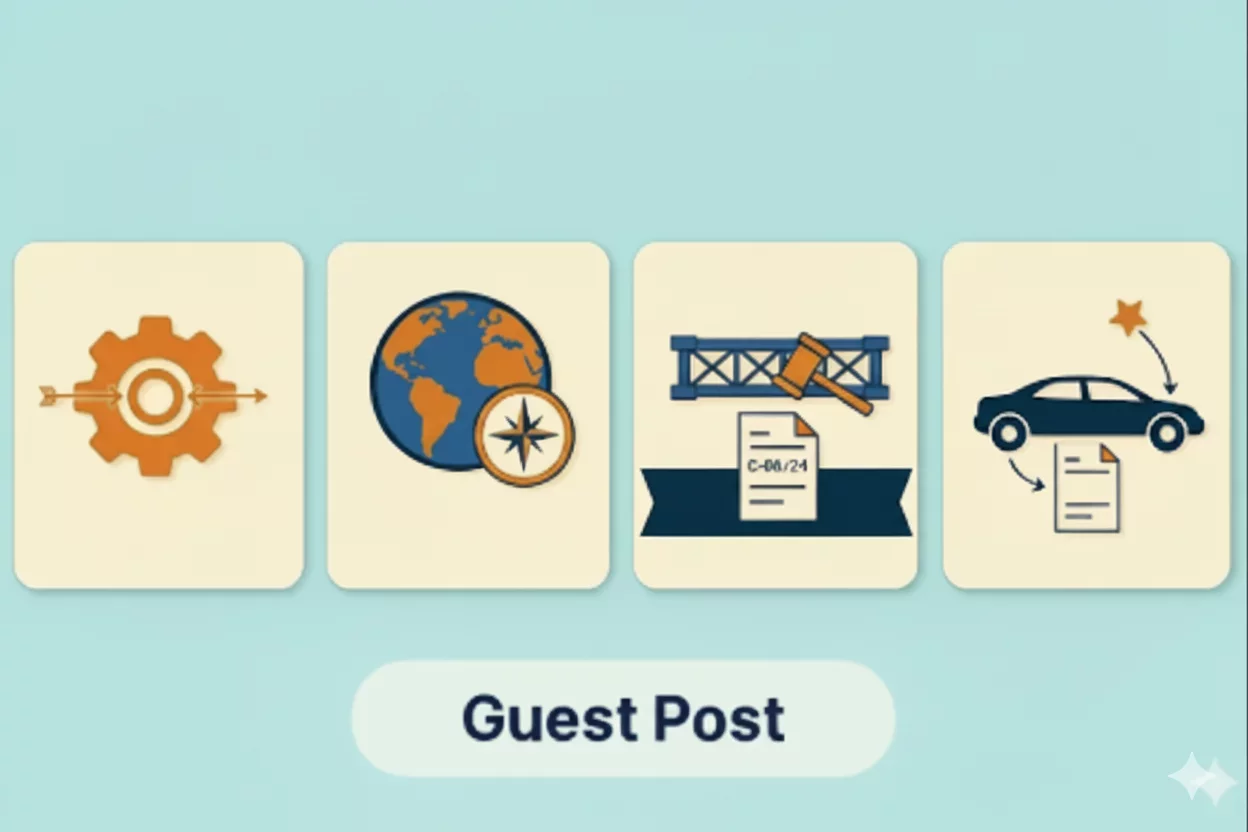
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



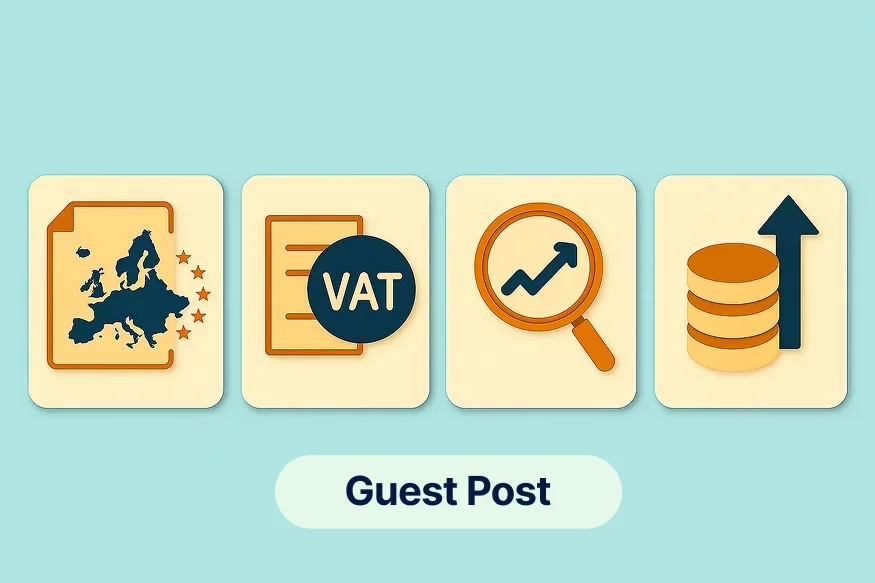
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

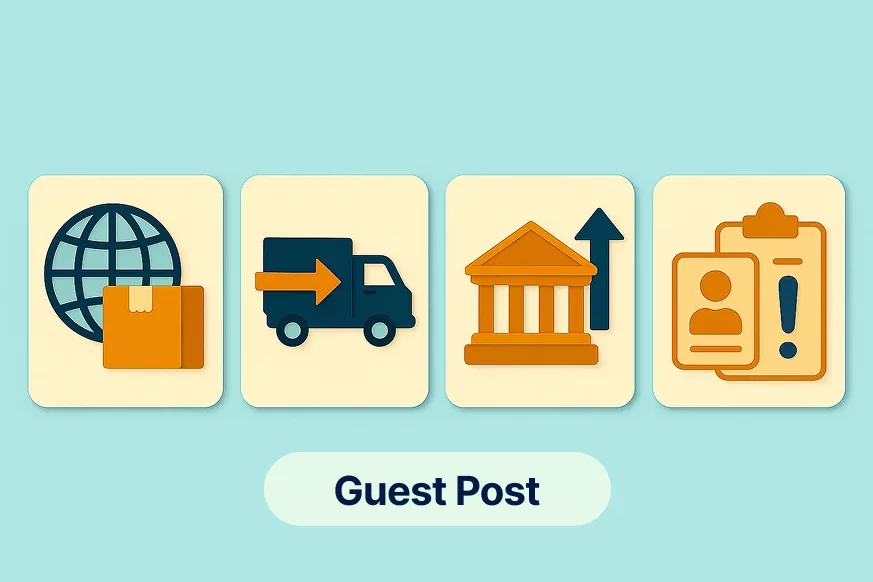
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
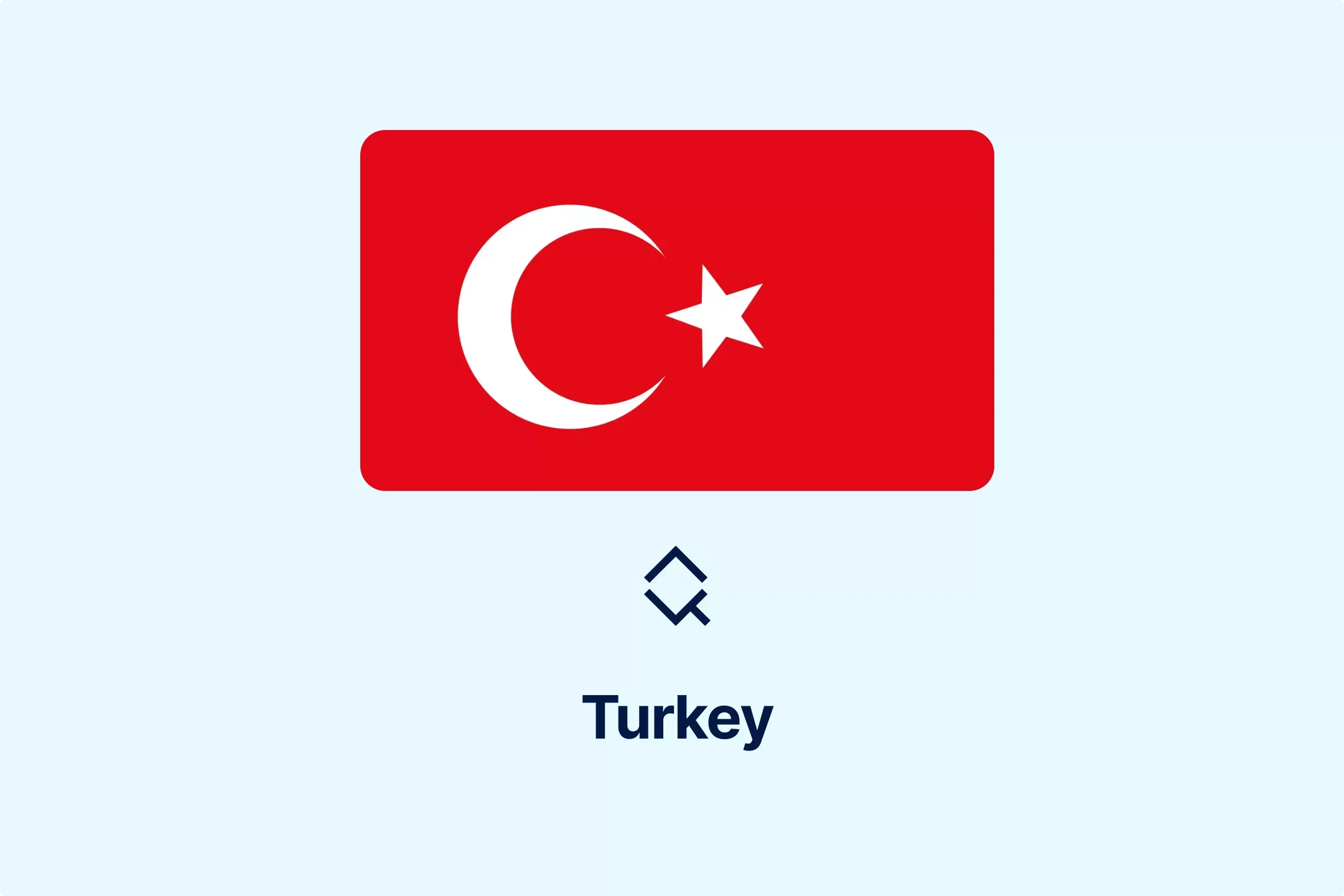
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)







-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

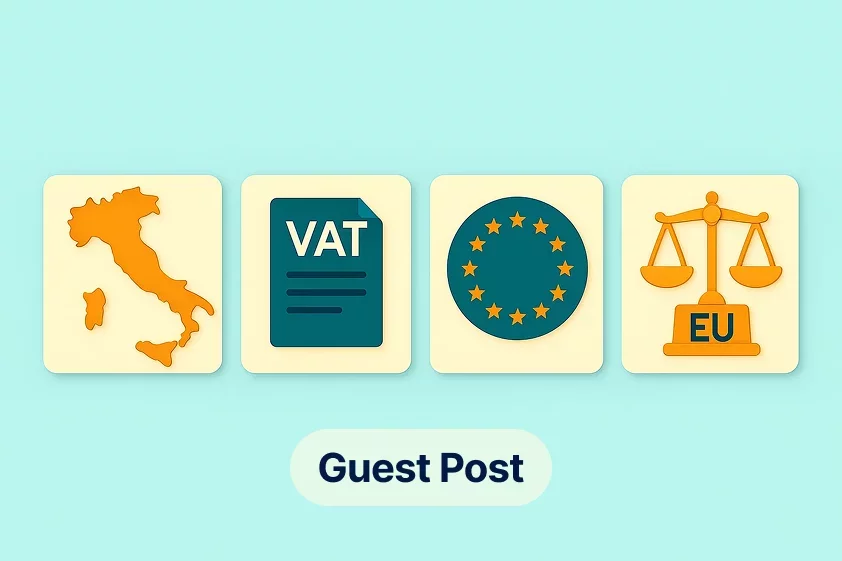

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





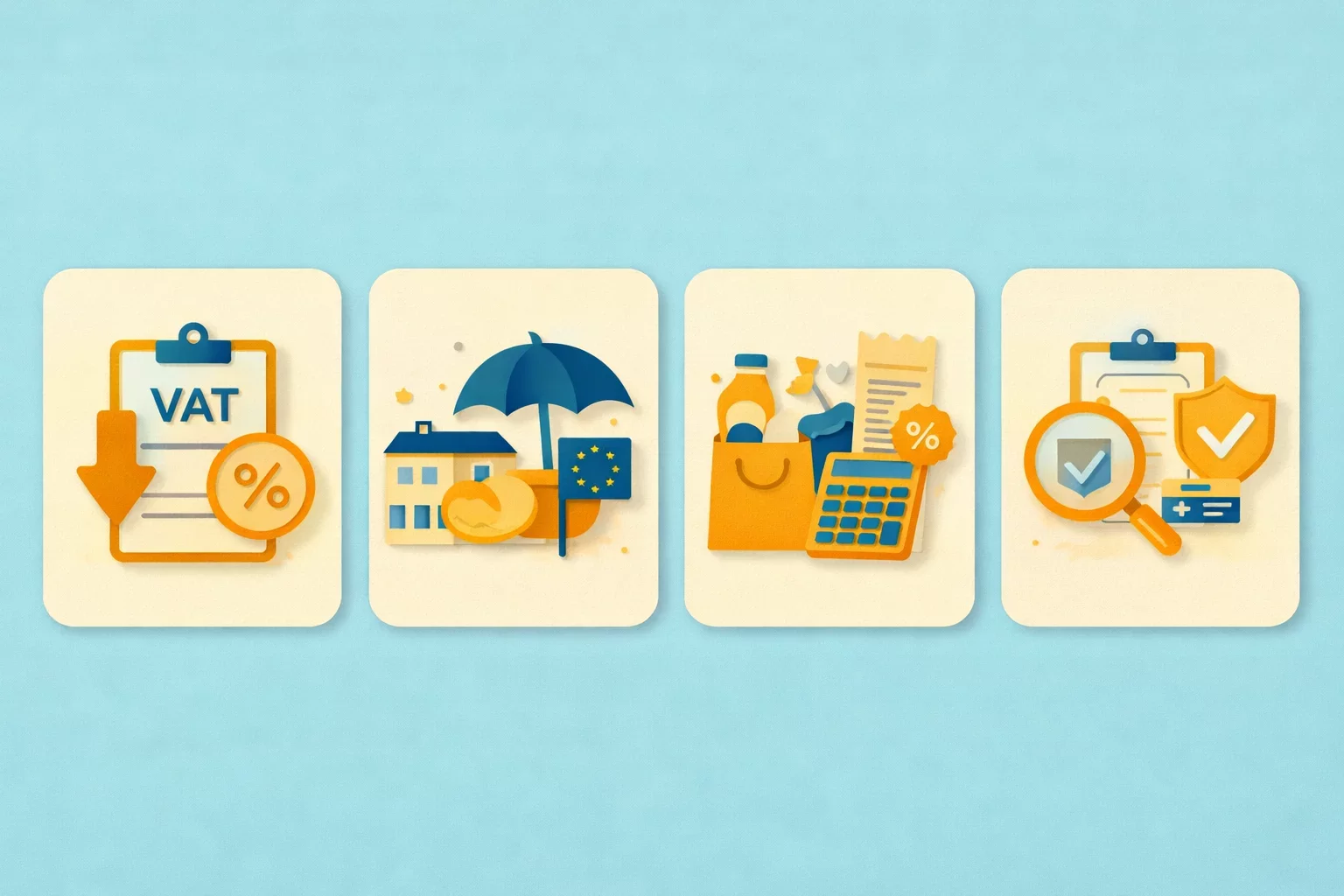
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)




-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)




































































































































