Der Einfluss des EuGH auf die nationalen Mehrwertsteuergesetze: Analyse der Rechtssache C-171/23

Der Gerichtshof der Europäischen Union, oft auch als Europäischer Gerichtshof (EuGH) bezeichnet, spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die EU-Mitgliedstaaten die Vorschriften der EU-Verträge einhalten.
Als wichtigste juristische Instanz für die Auslegung des EU-Rechts hat diese EU-Institution die Aufgabe, auf Ersuchen der nationalen Gerichte das EU-Recht auszulegen und zu klären.
In diesem Artikel geht es darum, wie sich das EuGH-Urteil auf die nationalen Mehrwertsteuergesetze auswirkt, indem erläutert wird, wo sich das EU-Recht und die nationalen Gesetze der EU-Mitgliedstaaten überschneiden und wie der Gerichtshof bei seiner Entscheidung vorgeht.
Wechselwirkung zwischen EU-Recht und nationalen Gesetzen der Mitgliedstaaten
Der EU-Rechtsrahmen basiert auf mehreren Gründungsverträgen, darunter der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der allgemeine Regeln für das Steuersystem der EU festlegt.
Was die MwSt-Vorschriften und -Verordnungen betrifft, so ist die Richtlinie 2006/112/EG des Rates, auch bekannt als die MwSt-Richtlinie, von zentraler Bedeutung für die Festlegung der EU-weiten und harmonisierten MwSt-Vorschriften. Die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie legt die grundlegenden Konzepte und Prinzipien fest, die die EU-Mitgliedstaaten in ihren nationalen Mehrwertsteuerrahmen integrieren müssen.
Zwar können die EU-Mitgliedstaaten bestimmte Punkte der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie an ihre spezifischen Bedürfnisse und Strategien anpassen, doch die Richtlinie legt Mindeststandards fest, die eingehalten werden müssen. So können die EU-Mitgliedstaaten zwar die geltenden Mehrwertsteuersätze und -befreiungen frei festlegen, doch muss das Mehrwertsteuersystem jedes Staates mit den EU-Grundsätzen übereinstimmen, um Handelshemmnisse zu vermeiden.
Wenn die EU-Länder das EU-Mehrwertsteuerrecht autonom auslegen können, kann dies zu Streitigkeiten führen, die der EuGH schlichten muss. Da es seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die nationalen und die EU-Vorschriften miteinander vereinbar sind und der Zusammenhalt der Union gewahrt bleibt, zielen die Urteile des EuGH darauf ab, die Mehrwertsteuergesetze einheitlich anzuwenden.
EuGH-Verfahren für Steuer- und Mehrwertsteuersachen
Die verschiedenen Arten von Verfahren vor dem EuGH lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe ist das Vorabentscheidungsverfahren, das es den nationalen Gerichten der EU-Mitgliedstaaten ermöglicht, den EuGH um eine Auslegung des EU-Mehrwertsteuerrechts zu ersuchen, wenn sie unsicher oder nicht in der Lage sind, dies selbst zu tun. Dieses Verfahren gewährleistet die korrekte Anwendung der EU-Mehrwertsteuervorschriften und trägt zur Beilegung von Streitigkeiten bei.
Die zweite Gruppe ist die der direkten Klagen und Rechtsmittel, die mehrere Arten von Verfahren umfasst, z. B. die Durchsetzung des Rechts, die von der Europäischen Kommission oder einem anderen EU-Mitgliedstaat gegen eine Regierung eingeleitet werden kann, die das EU-Recht nicht einhält, oder die Nichtigerklärung von EU-Rechtsakten, die vom Rat der EU, der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Parlament eingeleitet werden kann, wenn ein EU-Rechtsakt den EU-Verträgen widerspricht.
Andere Verfahren aus dieser Gruppe stellen sicher, dass die EU-Institutionen bei Bedarf Maßnahmen ergreifen oder Sanktionen gegen EU-Institutionen verhängen, wenn deren Handlungen oder die Handlungen ihrer Mitarbeiter Einzelpersonen oder Unternehmen schaden.
Um besser zu verstehen, wie diese Verfahren funktionieren, wird in diesem Artikel das Vorabentscheidungsverfahren behandelt.
Das Vorabentscheidungsverfahren und Mehrwertsteuerangelegenheiten
Die nationalen Gerichte müssen dem EuGH Fragen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer vorlegen, der dann entscheiden kann, ob er in der Sache entscheidet oder sie an das Gericht weiterleitet. Diese Phase wird als schriftliche Phase bezeichnet, in der alle beteiligten Parteien dem EuGH ihre schriftlichen Erklärungen vorlegen.
Sobald alle Schriftsätze vorliegen, fasst der Berichterstatter die eingegangenen schriftlichen Unterlagen zusammen, und die Rechtssache wird in der Vollversammlung des Gerichtshofs erörtert. Je nach Komplexität der Rechtssache wird in dieser Sitzung über die Anzahl der Richter entschieden, die sich mit der Rechtssache befassen werden. In dieser Sitzung wird auch entschieden, ob eine öffentliche mündliche Verhandlung stattfindet und ob der Generalanwalt um einen Schlussantrag ersucht wird.
Bei einer öffentlichen Verhandlung tragen die Anwälte beider Seiten ihre Fälle den Richtern und dem Generalanwalt vor, der ihnen Fragen zu den relevanten Punkten ihrer Ausführungen stellen kann. Wenn die Stellungnahme der AD erforderlich ist, hat die AD in der Regel einige Wochen Zeit, um sie zu verfassen und dem Gericht vorzulegen.
Nach Abschluss all dieser Schritte prüfen die Richter die vorgelegten Fakten, Erklärungen und Dokumente und entscheiden.
Wie funktioniert das nun in der Praxis?
Vorabentscheidungsverfahren in der Praxis
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise dieses Verfahrens wird auf einen kürzlich veröffentlichten Artikel über einen Streit zwischen einem in Kroatien ansässigen Unternehmen (Unternehmen) und dem kroatischen Finanzministerium verwiesen. Die kroatische Steuerverwaltung, die zum Finanzministerium gehört, forderte das Unternehmen auf, rund 18.000 EUR an fälliger Mehrwertsteuer und rund 320 EUR an Verzugszinsen zu zahlen.
Der Grund dafür war, dass die kroatische Steuerverwaltung feststellte, dass das Unternehmen gegründet wurde, um die für ein anderes Unternehmen geltende Mehrwertsteuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, d. h. um die Mehrwertsteuer zu hinterziehen.
Da das Unternehmen nicht der Ansicht war, dass es gegen ein Gesetz verstößt, legte es gegen diese Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Berufung ein. Nach Prüfung des Sachverhalts konnte der Verwaltungsgerichtshof nicht entscheiden, ob er EU-Recht im Zusammenhang mit dem Missbrauchsverbot anwenden kann. Angesichts dieser Zweifel am anwendbaren Recht legte das Verwaltungsgericht dem EuGH ein Ersuchen um Vorabentscheidung vor.
Nach Ermittlung aller relevanten Informationen und einer Analyse des geltenden EU- und kroatischen Rechtsrahmens traf der EuGH seine Entscheidung.
Auswirkungen der EuGH-Entscheidungen auf den Mehrwertsteuerrahmen
Die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung können aus der Perspektive der nationalen Regierungen, die für die Verabschiedung, Umsetzung und Durchsetzung von Steuer- und Mehrwertsteuergesetzen zuständig sind, und der Steuerpflichtigen, die diesen Gesetzen unterliegen, betrachtet werden.
Auf der einen Seite können die nationalen Gerichte, die die Vorabentscheidungen beantragen, die frühere EuGH-Entscheidung nutzen, um Streitigkeiten beizulegen und etwaige Unklarheiten und Widersprüche zwischen EU- und nationalem Mehrwertsteuerrecht zu beseitigen. Gibt es jedoch keine vergleichbaren Fälle, können sie jederzeit einen Antrag stellen und den EuGH bitten, über relevante mehrwertsteuerliche Fragen zu entscheiden, die die Anwendung von EU- und nationalem Recht weiter vertiefen könnten. In jedem Fall müssen sich alle nationalen Gerichte von dem Grundsatz leiten lassen, dass das EU-Recht Vorrang vor dem nationalen Recht hat.
Aus der Sicht der Steuerpflichtigen können sie das EuGH-Urteil nutzen, um mögliche Unsicherheiten zu vermeiden und die ordnungsgemäße Einhaltung der MwSt-Vorschriften sicherzustellen. Das EuGH-Urteil für ein EU-Land gilt für alle EU-Länder, was den Unternehmen helfen kann, ihre umsatzsteuerbezogenen Entscheidungen besser zu treffen.
Herausforderungen bei der Umsetzung von EuGH-Entscheidungen auf nationaler Ebene
Die Umsetzung von EuGH-Entscheidungen auf nationaler Ebene ist nicht unproblematisch. Entscheidungen, in denen festgestellt wird, dass nationale Gesetze im Widerspruch zum EU-Recht stehen, verpflichten die EU-Länder in der Regel dazu, diese Regeln oder Praktiken zu ändern.
Da der Prozess der Rechtsetzung und -änderung von mehreren Faktoren abhängt, müssen die nationalen Regierungen manchmal viel Zeit und Mühe darauf verwenden. Darüber hinaus könnten einige Länder zögern, das EuGH-Urteil umzusetzen, wenn es mit nationalen Interessen und Maßnahmen zum Schutz bestimmter Branchen oder Wirtschaftsstrukturen kollidiert.
Schlussfolgerung
EuGH-Entscheidungen sind für die Gestaltung der EU-Mehrwertsteuerlandschaft von wesentlicher Bedeutung und bringen die dringend benötigte Klarheit und Sicherheit bei der Umsetzung der einschlägigen MwSt-Vorschriften. Während sie für die nationalen Gerichte und Regierungen in der EU verbindlich sind, sollten sich auch die Steuerpflichtigen über die neuesten Entscheidungen informieren, da sie ihnen helfen können, die Vorschriften einzuhalten oder zu erfüllen.
Quelle: Curia - Die Institution, Curia - Gerichtshof, Kurie - Allgemeines Gericht, Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Europäisches Parlament - Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen Union, EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, VATabout - EuGH Rechtssache - Entscheidung über den Missbrauch des Rechts auf Mehrwertsteuerbefreiung in Kroatien (C-171/23)

Ausgewählte Einblicke
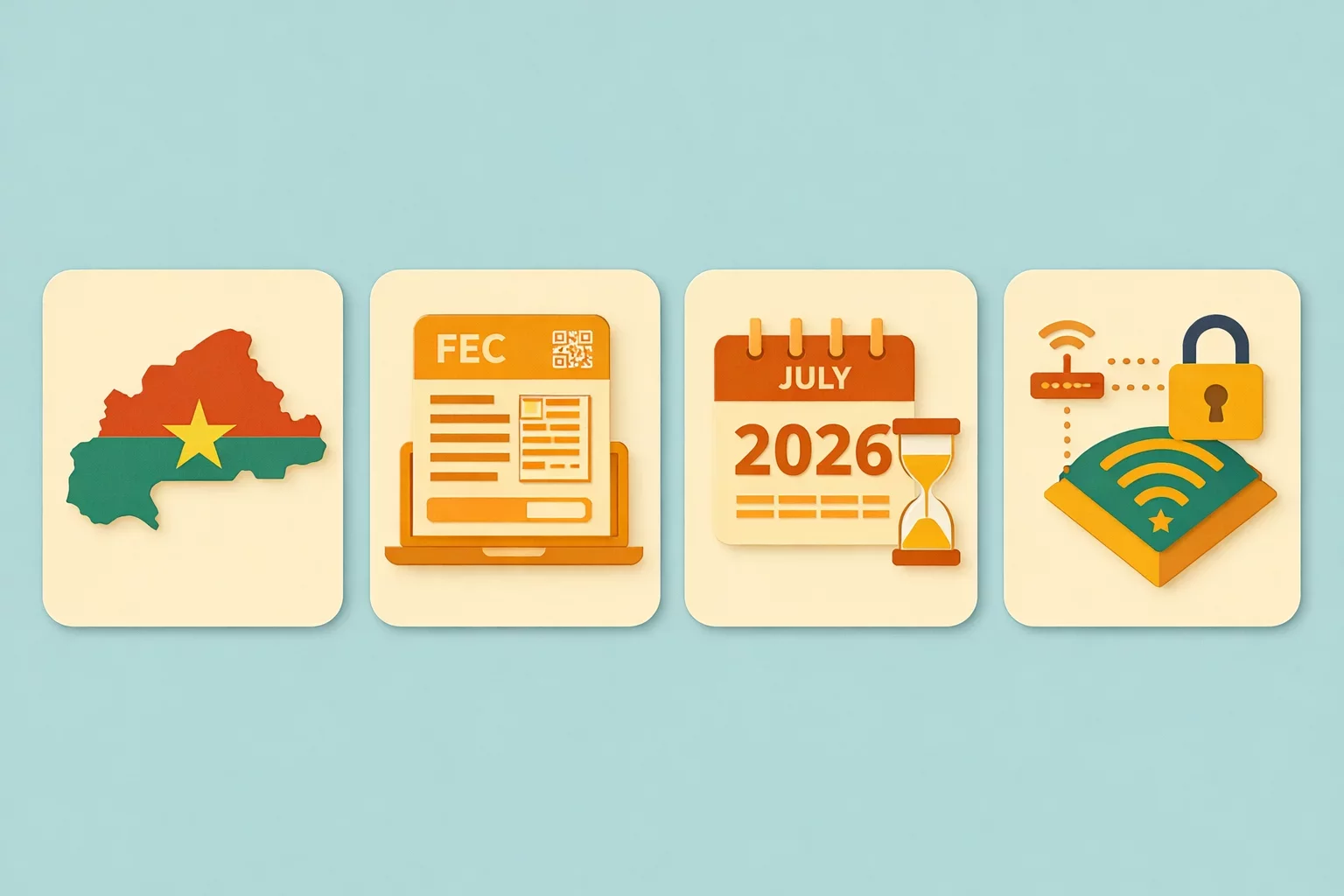
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
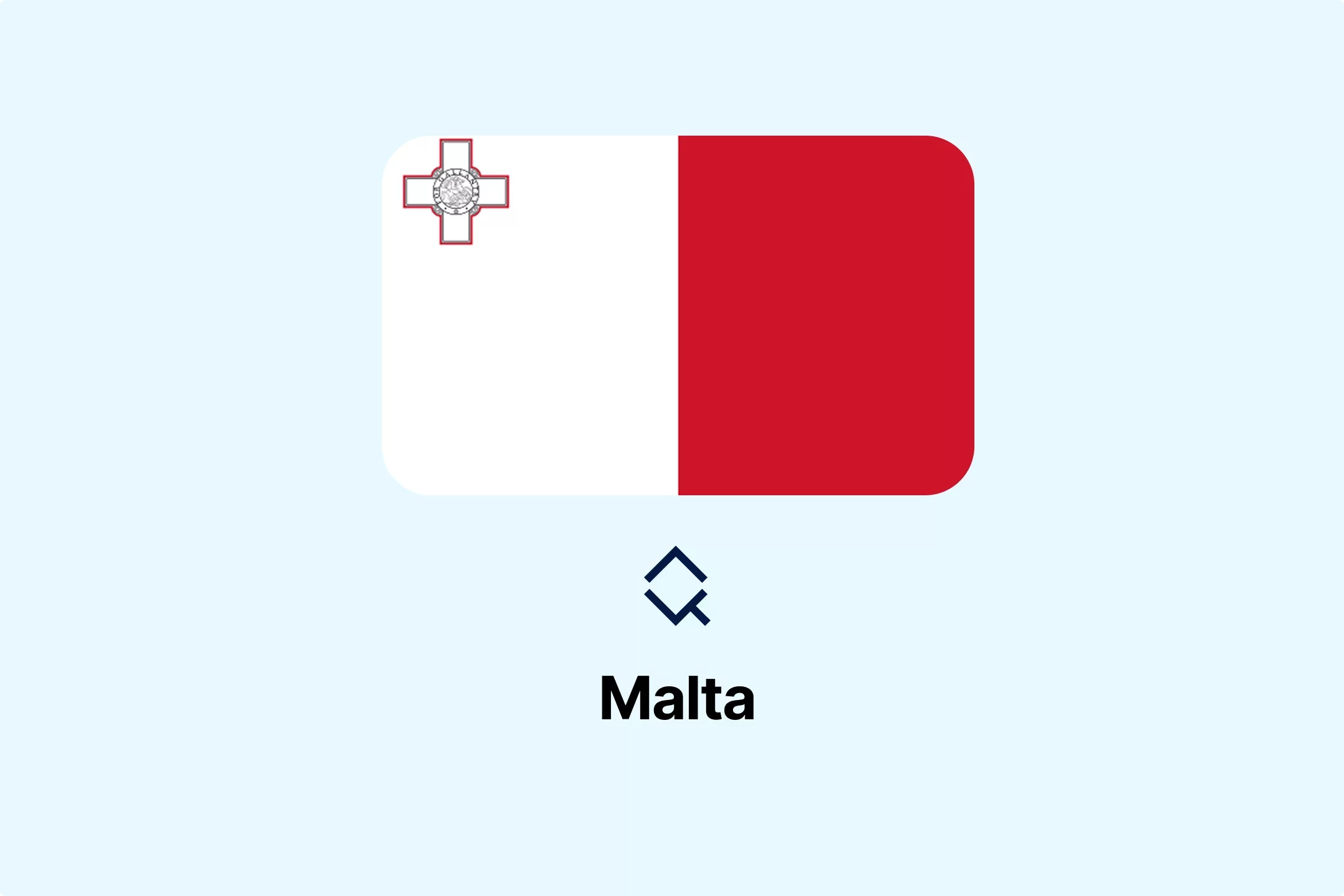
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
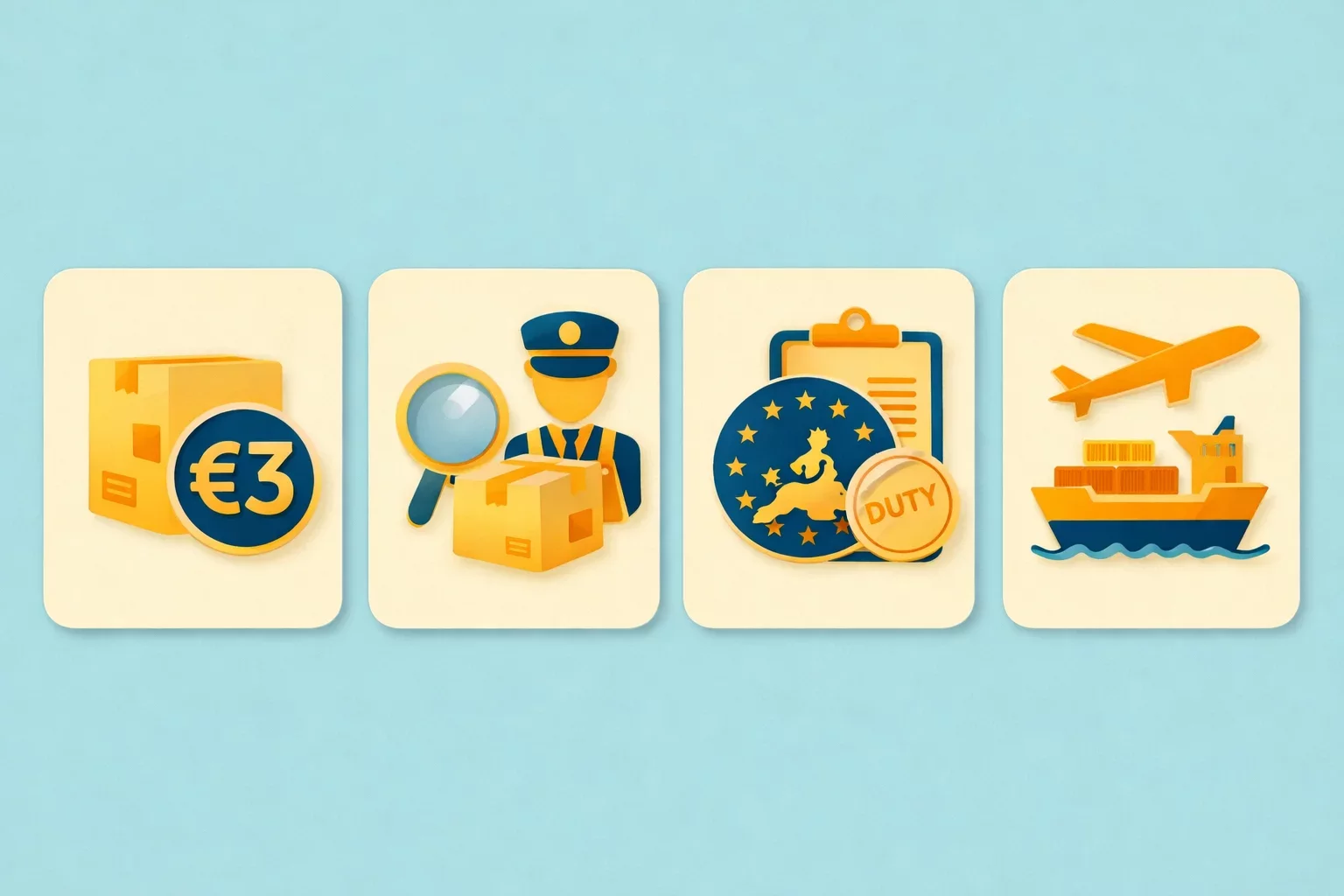


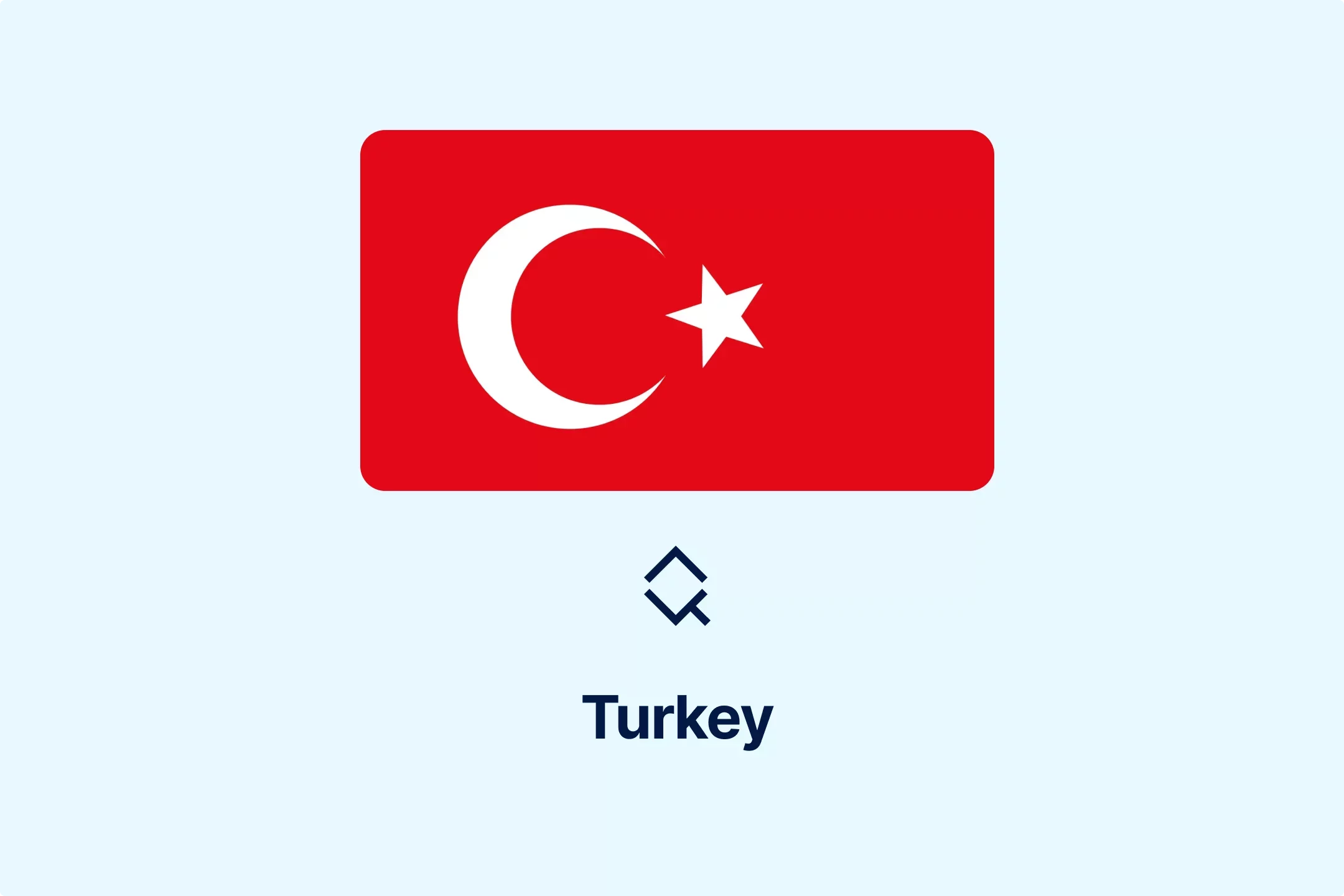




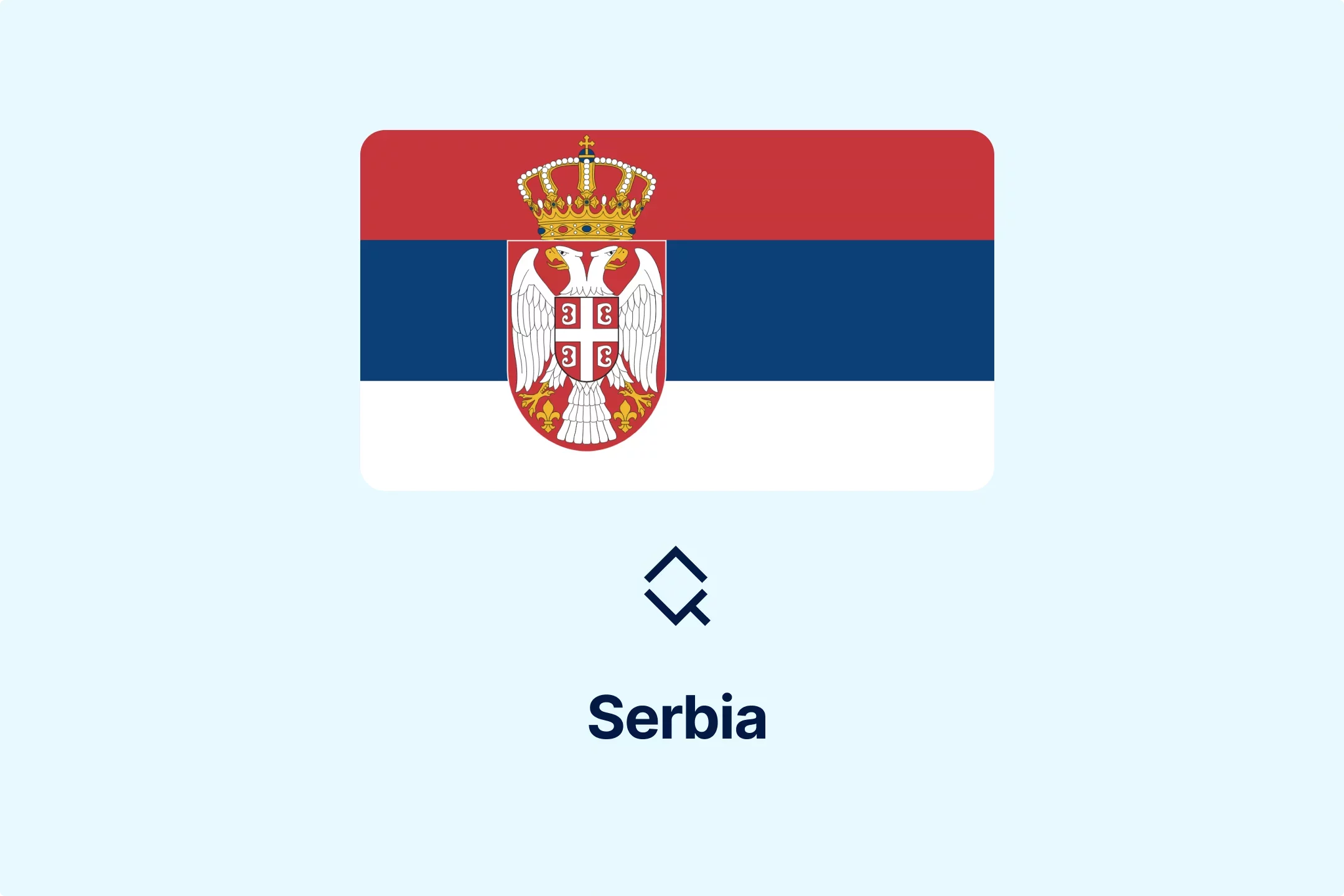
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



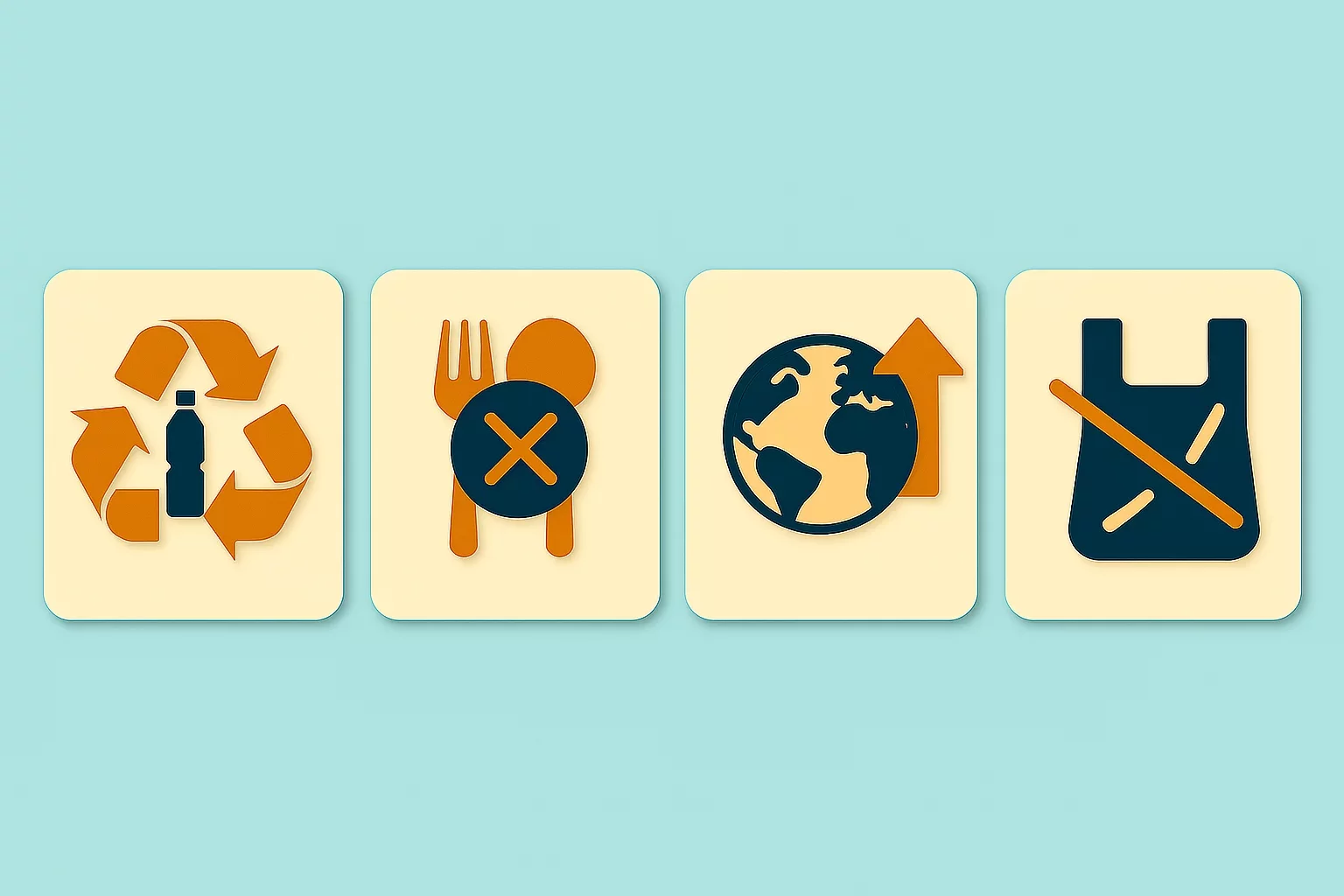


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
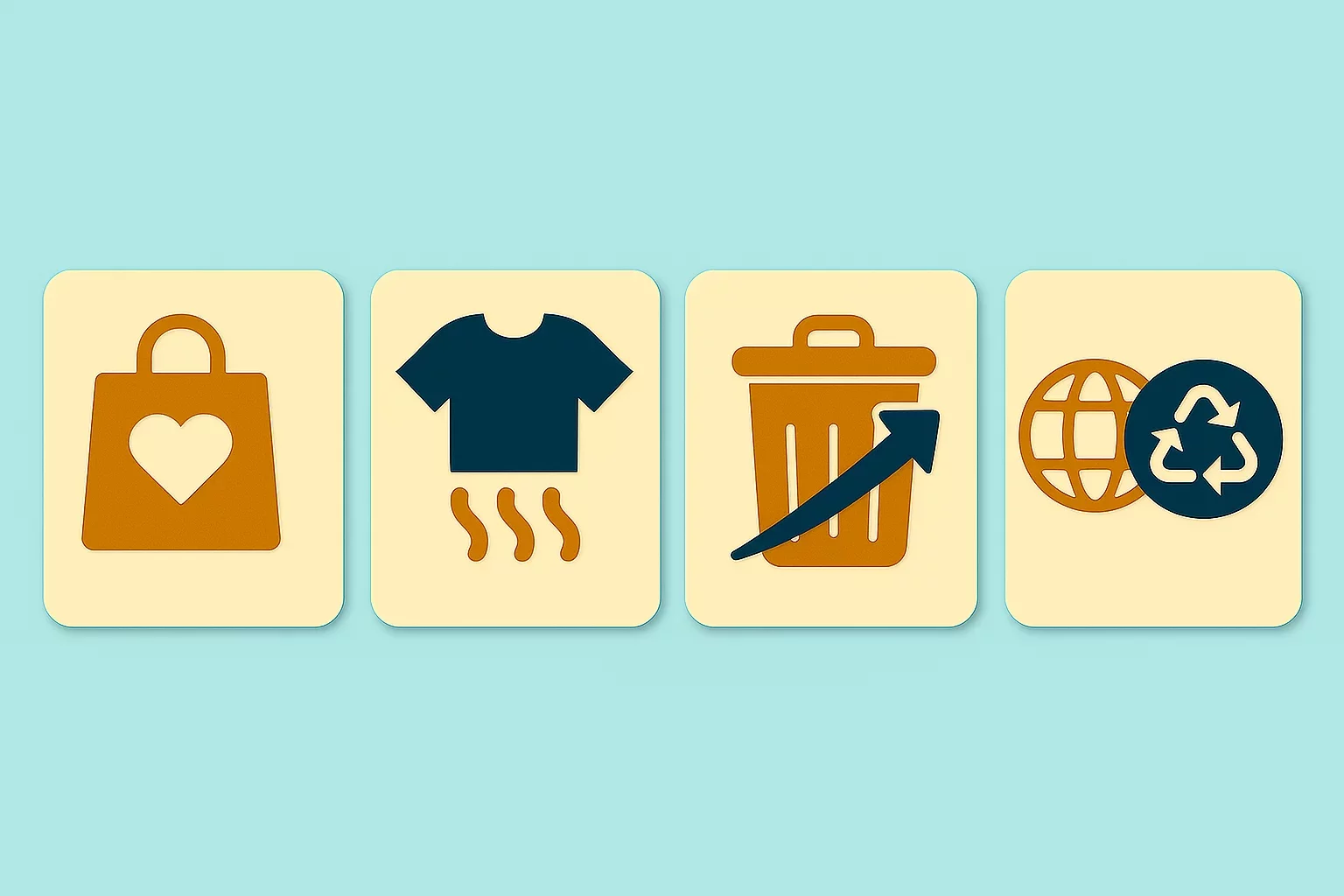

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
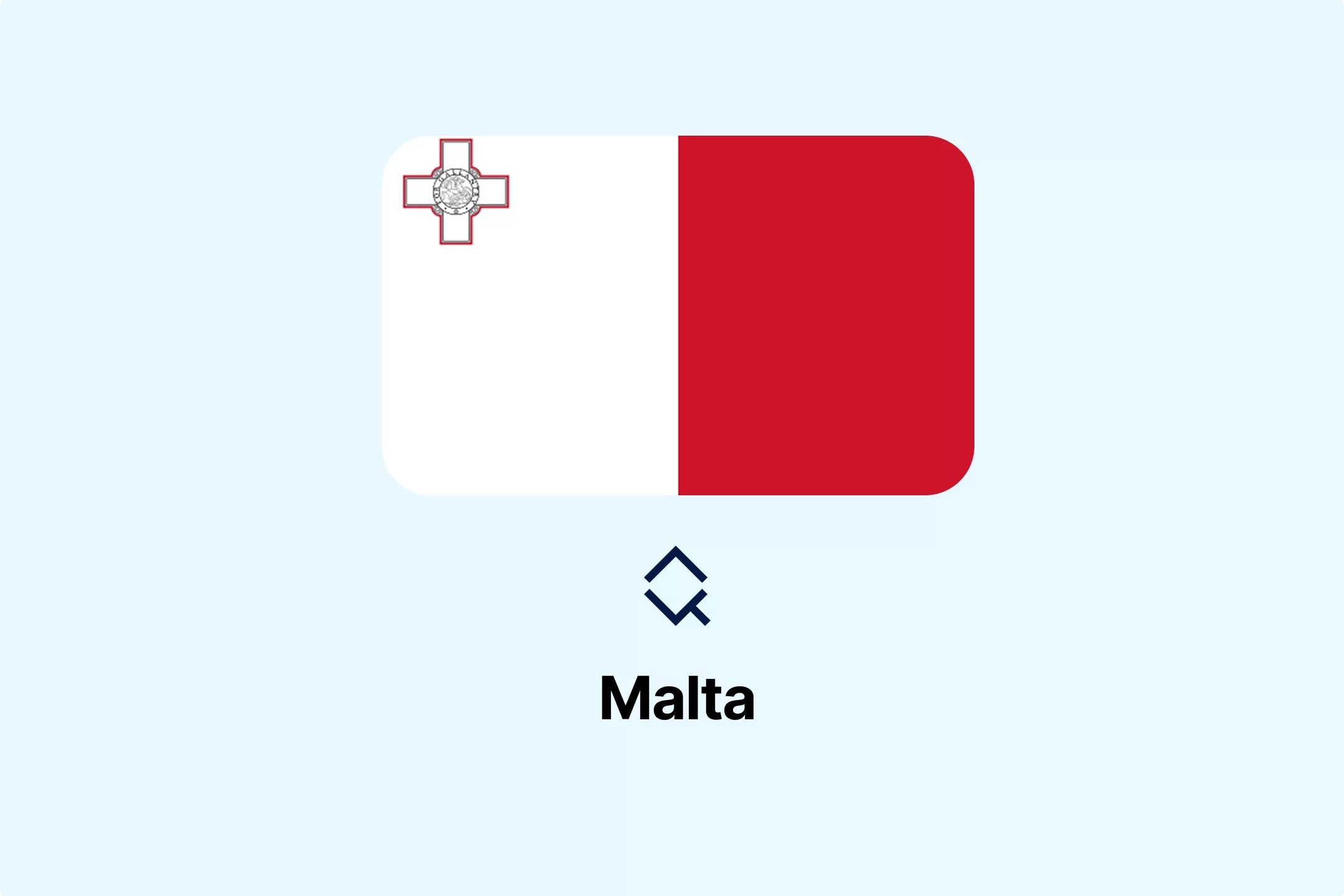
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
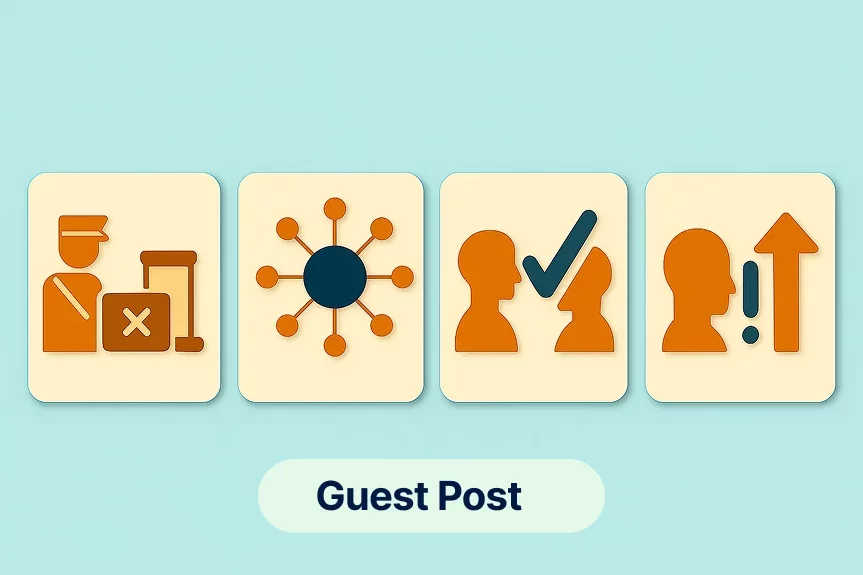

-hafis0ii23.webp)

-qseaw5zmcy.webp)


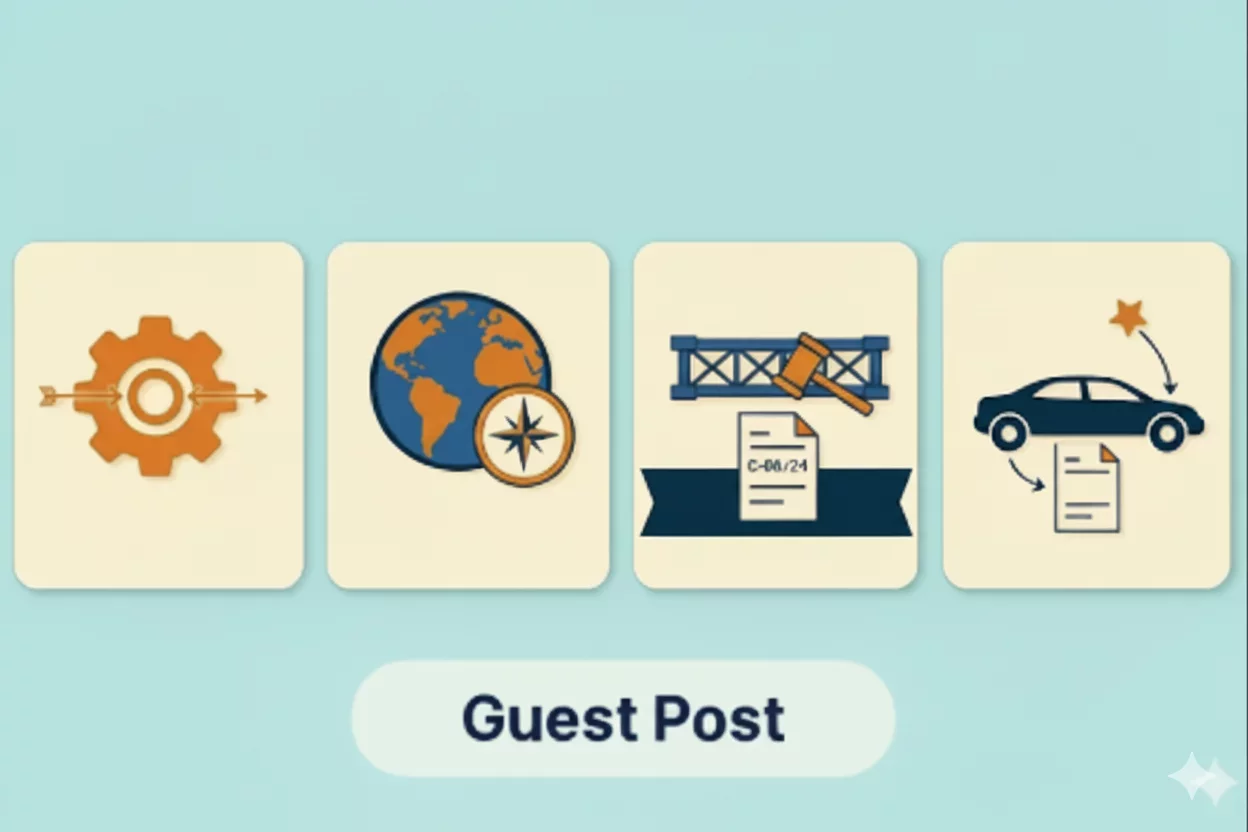
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



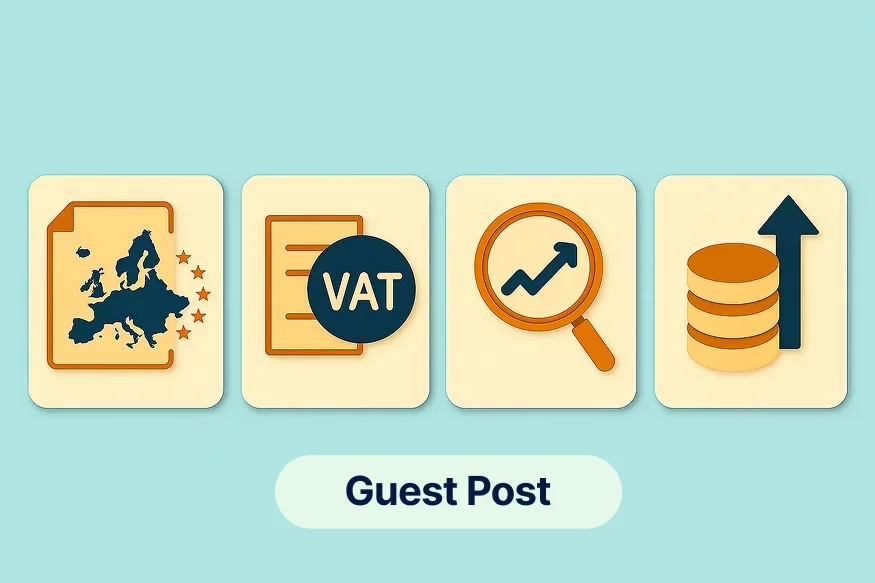
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

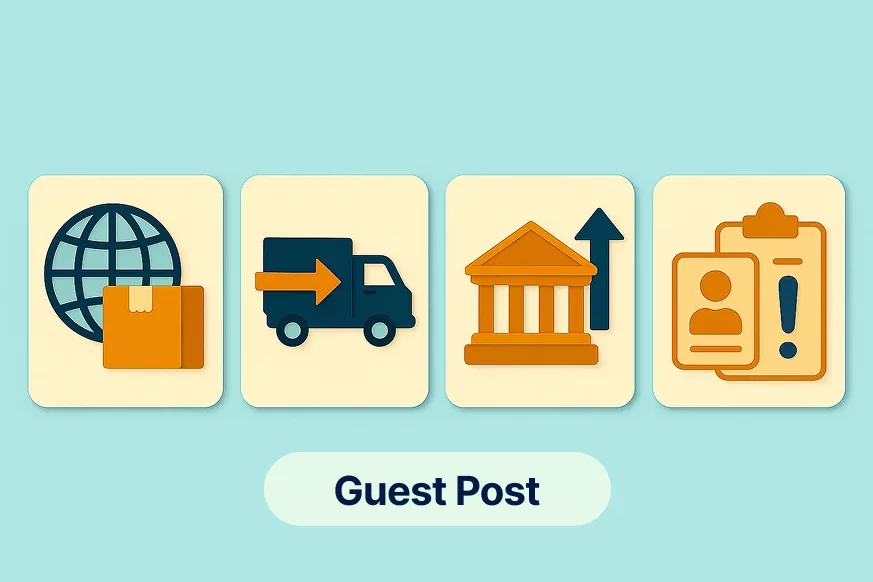
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
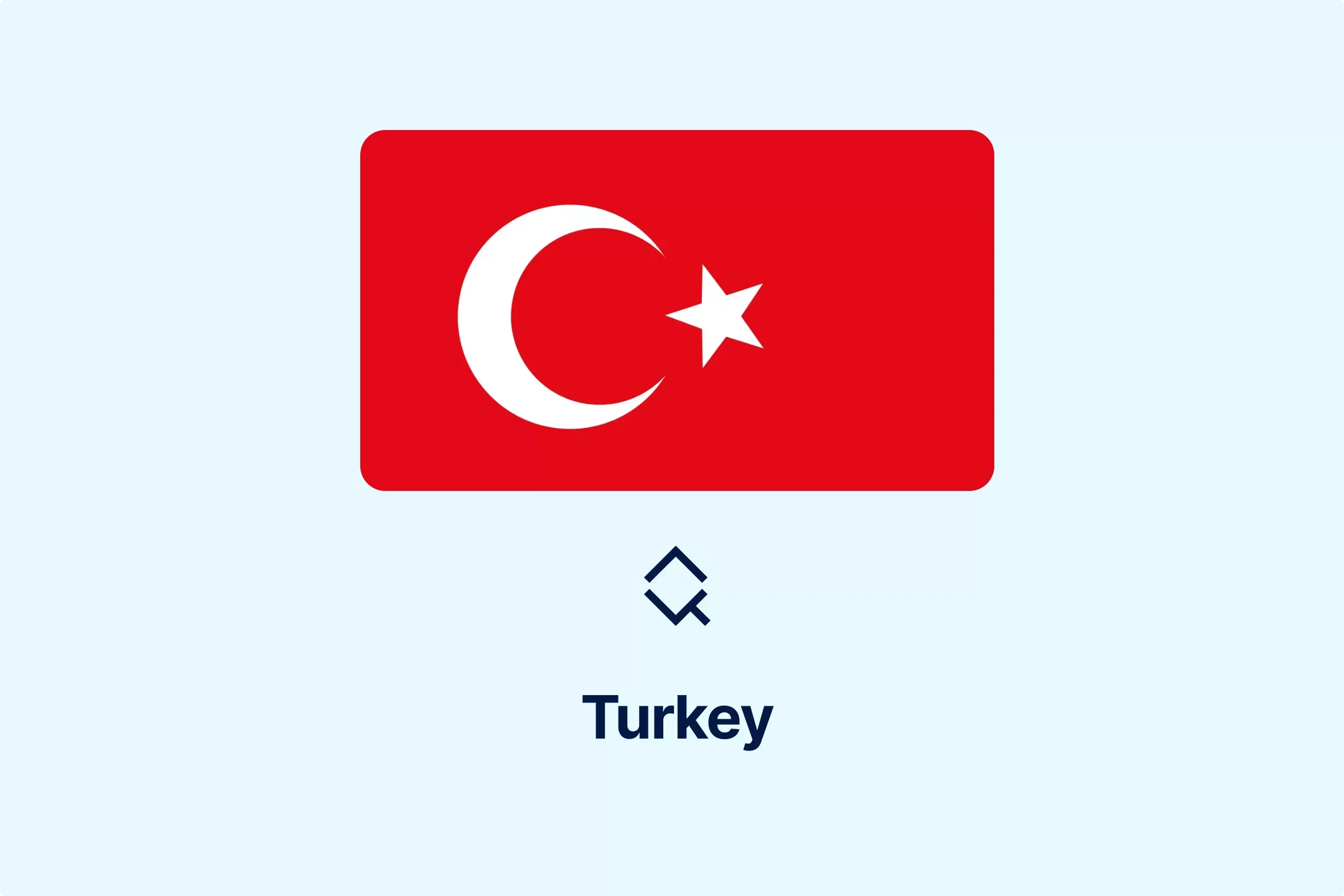
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)








-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

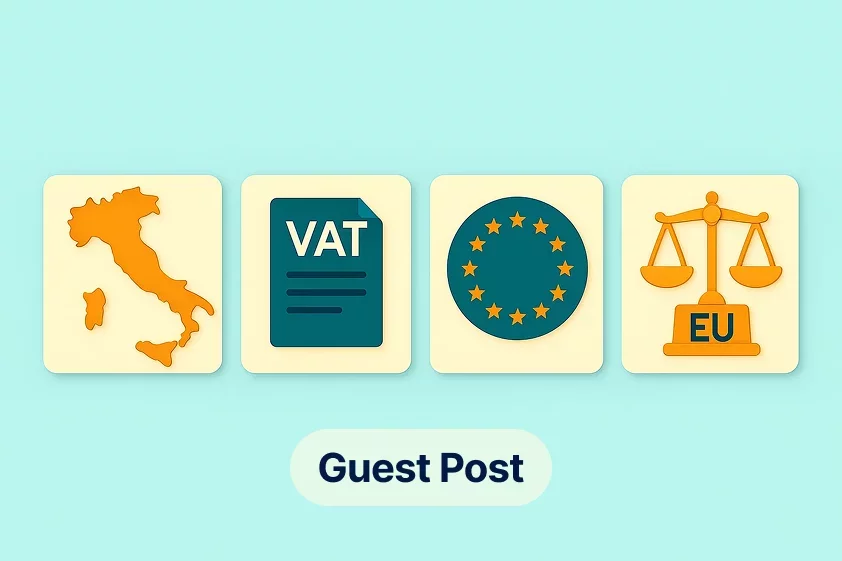

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





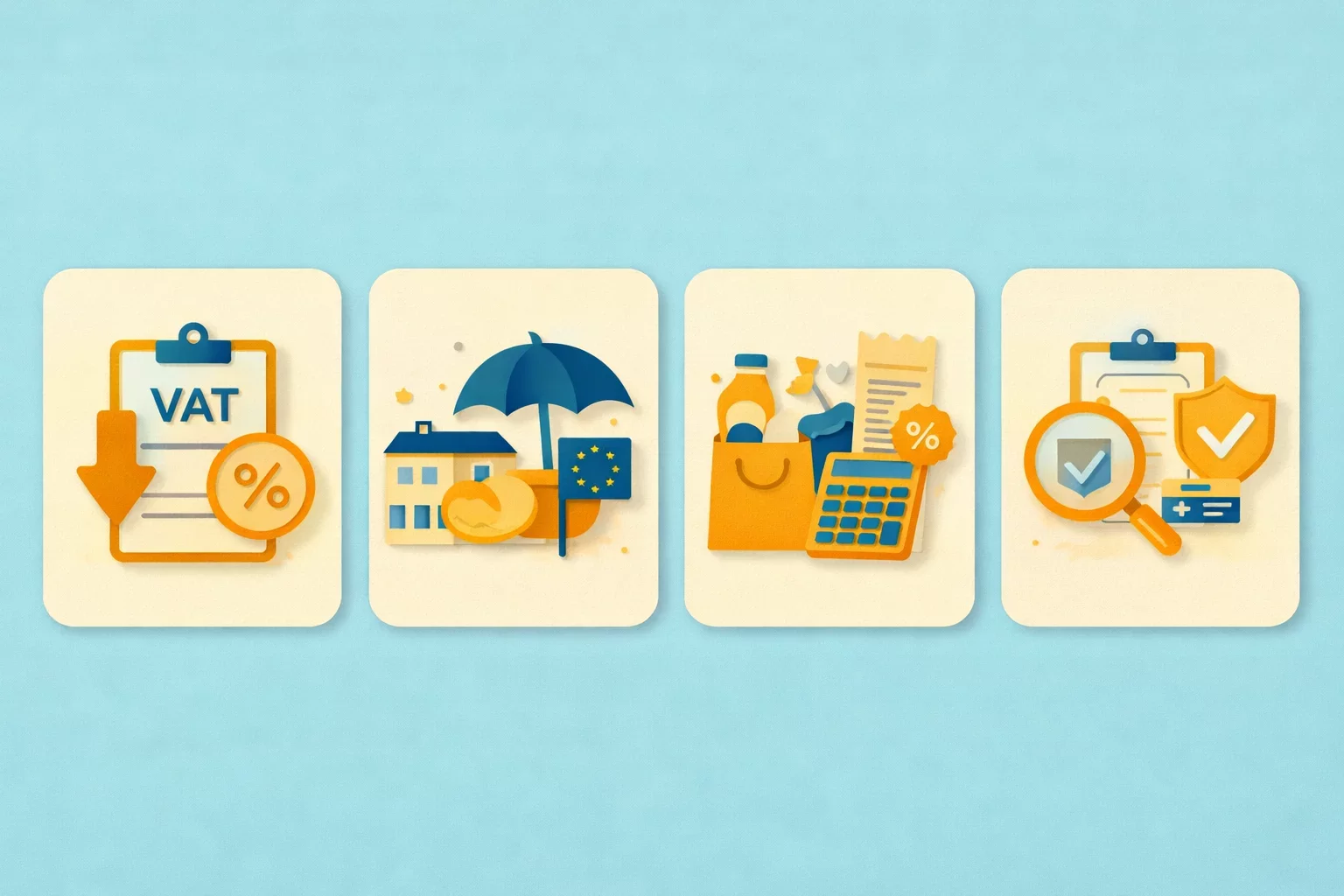
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)




-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)



































































































































