EuGH-Urteil in der Rechtssache C-164/24 über die Abmeldung von der Mehrwertsteuer: Fairness und Verhältnismäßigkeit im EU-Steuerrecht

🎧 Lieber zuhören?
Holen Sie sich die Audioversion dieses Artikels und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne lesen zu müssen - perfekt für Multitasking oder Lernen unterwegs.
Cityland, ein bulgarisches Bauunternehmen, sah sich aufgrund der Feststellungen der Steuerbehörden bei der Steuerprüfung mit steuerlichen und rechtlichen Problemen konfrontiert. Die Steuerbehörde stellte fest, dass das Unternehmen fortlaufend gegen die Mehrwertsteuervorschriften verstieß, und strich das Unternehmen schließlich aus dem Mehrwertsteuerregister.
Der Fall wurde jedoch vor das Verwaltungsgericht gebracht, das die Frage aufwarf, ob die bulgarische Mehrwertsteuer mit der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie vereinbar ist und ob ein Ausschluss aus dem Mehrwertsteuersystem aufgrund von formalen Rechtsverstößen nach EU-Recht zulässig ist.
Hintergrund des Falles
Im Jahr 2022 führte die bulgarische Steuerbehörde eine Steuerprüfung bei Cityland durch und stellte fest, dass das Unternehmen für fünf Steuerzeiträume zwischen 2013 und 2018 keine erklärte und fällige Mehrwertsteuer entrichtet hatte. Außerdem strich die Steuerbehörde das Unternehmen aus dem Mehrwertsteuerregister.
Cityland legte gegen diese Entscheidung beim Direktor der Direktion für Berufungen und Steuer- und Sozialversicherungspraxis (Direktor) Berufung ein und machte geltend, dass die gemeldete und nicht gezahlte Mehrwertsteuer sich auf Rechnungen bezog, die auf ein anderes Unternehmen ausgestellt worden waren, das Gegenstand eines Gerichtsverfahrens war, weil es die in den Rechnungen angegebene Mehrwertsteuer nicht gezahlt hatte.
Dennoch bestätigte der Direktor im Dezember 2022 die Entscheidung der Steuerbehörde und erklärte, dass die fällige Mehrwertsteuer im Oktober 2022 gezahlt wurde und nur noch eine Zinszahlung in Höhe von 6.264.022 BGN zu leisten sei.
Cityland war nicht bereit, das Ergebnis des Berufungsverfahrens zu akzeptieren und brachte den Fall vor das Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht war sich jedoch nicht sicher, ob die bulgarischen Gesetze, die die Streichung des Unternehmens aus dem Mehrwertsteuerregister ermöglichen, mit den EU-Vorschriften vereinbar sind.
Das Verwaltungsgericht fügte hinzu, dass die Steuerbehörde nach den nationalen MwSt-Vorschriften nicht verpflichtet ist, das Verhalten oder die Absichten eines Steuerpflichtigen eingehend zu prüfen, wenn sie feststellt, ob ein Risiko für die Steuereinnahmen oder ein möglicher Steuerbetrug besteht. Außerdem können die Steuerbehörden Steuerpflichtige allein aufgrund von drei formalen Verstößen aus dem Mehrwertsteuersystem ausschließen: verspätete Abgabe der Steuererklärung, verspätete Zahlung der Mehrwertsteuer oder verspätete Ausstellung der Rechnung.
Stellt die Steuerbehörde auch nur einen der drei genannten Verstöße fest, kann sie den Steuerpflichtigen aus dem Mehrwertsteuerregister streichen, ohne seine besonderen Umstände oder sein Gesamtverhalten zu berücksichtigen.
Aufgrund von Zweifeln an der Vereinbarkeit dieser Vorschriften mit den EU-Mehrwertsteuervorschriften unterbrach das Verwaltungsgericht das Verfahren und legte dem EuGH vier separate, aber miteinander verbundene Fragen vor.
Die wichtigsten Fragen aus dem Antrag auf Erlass einer Entscheidung
Die erste dem EuGH vorgelegte Frage lautet, ob eine bestimmte Bestimmung des bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes im Widerspruch zu Artikel 213 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie steht. Falls diese Bestimmungen unvereinbar sind, lautet die zweite Frage, ob die einschlägigen EU-Bestimmungen unmittelbare Wirkung haben, so dass sich Einzelpersonen vor nationalen Gerichten unmittelbar auf sie berufen können.
Nehmen wir jedoch an, der EuGH kommt zu dem Schluss, dass kein Konflikt zwischen nationalem und EU-Recht besteht. In diesem Fall lautet die dritte Frage, ob das EU-Recht den Ausschluss vom System des freien Dienstleistungsverkehrs allein aufgrund von formalen Verstößen oder Zuwiderhandlungen ohne Berücksichtigung mildernder Umstände erlaubt.
Für den Fall, dass die erste Frage verneint wird, fragt der Verwaltungsgerichtshof schließlich, ob gleichzeitige Sanktionen wie Ausschluss und Zinsen ohne vorherige Prüfung der Situation des einzelnen Steuerpflichtigen zulässig sind.
Anwendbare EU-Mehrwertsteuerrichtlinie Artikel
Artikel 2(1), 213(1), 214(1), 273, 362, 363, 369q und 369r sind die wichtigsten Artikel der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, die der EuGH zur Beantwortung der vom Verwaltungsgerichtshof gestellten Fragen herangezogen hat.
Neben der Auflistung der Arten von Umsätzen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, und der Verpflichtung der Steuerpflichtigen, die nationalen Steuerbehörden über die Aufnahme, Änderung oder Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit zu informieren, schreibt der Artikel den EU-Ländern auch vor, jedem Steuerpflichtigen eine eindeutige Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zuzuweisen.
Darüber hinaus erlaubt Artikel 273 den EU-Ländern, zusätzliche Vorschriften zur Verhinderung von MwSt-Betrug und zur ordnungsgemäßen Erhebung der MwSt festzulegen, solange diese Vorschriften inländische und grenzüberschreitende Umsätze gleich behandeln und keine zusätzliche Belastung für die Rechnungsstellung mit sich bringen.
In den Artikeln 362 und 363 heißt es, dass die EU-Länder Nicht-EU-Unternehmen, die Dienstleistungen in der EU erbringen, eindeutige Mehrwertsteuernummern zuteilen sollten. Darüber hinaus sehen die Bestimmungen vor, dass die EU-Länder Nicht-EU-Unternehmen aus dem Mehrwertsteuersystem ausschließen können, wenn sie wiederholt gegen die Vorschriften verstoßen.
In ähnlicher Weise beziehen sich die Artikel 369q und 369r auf Unternehmen, die importierte Waren im Fernabsatz verkaufen. Diese Steuerpflichtigen erhalten für die Regelung ebenfalls eine einmalige MwSt-Nummer, die nur für diese Verkäufe verwendet werden darf. Sie können auch aus dem Mehrwertsteuerregister gestrichen werden, wenn sie ihren Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen.
Nationale MwSt-Vorschriften in Bulgarien
Artikel 106 des bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes besagt, dass Steuerpflichtige aus dem Mehrwertsteuerregister gestrichen werden können, wenn sie einen Antrag auf freiwillige oder obligatorische Streichung aus dem Register stellen, oder von der Steuerbehörde aus zwingenden Gründen oder aus bestimmten, in Artikel 176 genannten Gründen.
Die beharrliche Nichterfüllung der mehrwertsteuerlichen Pflichten ist einer der Hauptgründe, aus denen die Steuerbehörde die Registrierung von Steuerpflichtigen für die Mehrwertsteuer oder deren Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister ablehnt, wie in Artikel 176 festgelegt. In einer ergänzenden Bestimmung des Mehrwertsteuergesetzes wird der Begriff "beharrlich" weiter präzisiert, indem gesagt wird, dass beharrliche Verstöße wiederholte Verstöße derselben Art sind, die innerhalb eines Jahres nach dem Wirksamwerden einer früheren Sanktionsentscheidung begangen werden.
Bedeutung des Falles für Steuerpflichtige
Das EuGH-Urteil im vorliegenden Fall trägt zur Schaffung eines vertrauensvolleren Geschäfts- und Mehrwertsteuerumfelds bei und schützt Steuerpflichtige vor ungerechtfertigten Maßnahmen, die von den nationalen Rechtsvorschriften der EU-Länder auferlegt werden. Darüber hinaus unterstreicht das Urteil die Notwendigkeit für die nationalen Steuerbehörden, jeden einzelnen Fall gründlich zu prüfen und festzustellen, ob die Handlungen des Steuerpflichtigen Maßnahmen wie die Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister erfordern und rechtfertigen.
Darüber hinaus unterstreicht das Urteil die Bedeutung von Verhältnismäßigkeit, Fairness und Rechtssicherheit bei der Durchsetzung der Mehrwertsteuer und stellt sicher, dass die Sanktionen im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften nicht nur praktisch und abschreckend, sondern auch fair und mit den Grundsätzen des EU-Rechts vereinbar sind.
Analyse der Feststellungen des Gerichtshofs
Mit der ersten Frage möchte der Verwaltungsgerichtshof im Wesentlichen wissen, ob die EU-Mehrwertsteuervorschriften und der Grundsatz der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit die nationalen Vorschriften daran hindern, der Steuerbehörde zu gestatten, Steuerpflichtige allein wegen der Nichterfüllung von Mehrwertsteuerverpflichtungen von der Mehrwertsteuer auszuschließen, ohne auf die Einzelheiten der Verstöße einzugehen.
Obwohl die EU-Länder bei der Durchführung von Maßnahmen zur Identifizierung von Steuerpflichtigen für MwSt-Zwecke über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen, ist dieses Recht nicht unbegrenzt. Die EU-Länder können die Vergabe von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern nur aus berechtigten Gründen verweigern.
Was die Streichung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern betrifft, so erlaubt die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie den EU-Ländern im Allgemeinen nicht, Steuerpflichtige aus den Umsatzsteuerregistern zu streichen. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel, z. B. für Steuerpflichtige, die im Rahmen besonderer Mehrwertsteuerregelungen tätig sind. In diesen Fällen ist eine Streichung zulässig, wenn die Steuerpflichtigen die für diese Sonderregelungen festgelegten Vorschriften wiederholt nicht einhalten.
Da die EU-Länder geeignete administrative und legislative Maßnahmen ergreifen müssen, um die Erhebung der fälligen Mehrwertsteuer zu gewährleisten und Betrug zu verhindern, haben sie das Recht, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Streichung von Steuerpflichtigen aus dem Mehrwertsteuerregister. Solche Maßnahmen müssen jedoch mit dem EU-Recht und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang stehen.
Der EuGH fügte hinzu, dass die EU-Länder nach den geltenden EU-Vorschriften Sanktionen für die wiederholte Nichteinhaltung der MwSt-Vorschriften frei festlegen können. Dabei müssen sie jedoch das EU-Recht und dessen Grundprinzipien, insbesondere die Verhältnismäßigkeit und die Steuerneutralität, beachten.
Um die Verhältnismäßigkeit einer Sanktion zu beurteilen, müssen die Gesetzgeber Faktoren wie die Art und Schwere des Verstoßes und die Methode zur Berechnung der Sanktion berücksichtigen. Außerdem müssen die Sanktionen wirksam und abschreckend sein und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Verstoß stehen.
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen fügte der EuGH hinzu, dass die Streichung von Steuerpflichtigen aus dem Mehrwertsteuerregister ohne Berücksichtigung der spezifischen Art der Verstöße nicht als eine Sanktion angesehen werden kann, die den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, der Gerechtigkeit und der Wirksamkeit entspricht.
Da die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den Nachweis des steuerlichen Status eines Steuerpflichtigen von entscheidender Bedeutung ist, könnte ihre Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister dessen Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen. Darüber hinaus kann die Streichung von Steuerpflichtigen als Sanktion für die Nichterfüllung von Mehrwertsteuerpflichten als hart empfunden werden.
Darüber hinaus entspricht die Streichung von Steuerpflichtigen aus dem Mehrwertsteuerregister ohne vollständige Untersuchung der Art und Schwere der Verstöße nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine gründliche und unparteiische Untersuchung ist notwendig, um die Fairness und Zuverlässigkeit der Maßnahmen der Steuerbehörden zu gewährleisten.
Schließlich unterstrich der EuGH, dass nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit der steuerliche Status der Steuerpflichtigen, einschließlich der Rechte und Pflichten gegenüber der Steuerbehörde, nicht ungewiss oder auf unbestimmte Zeit anfechtbar sein sollte. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Sanktion, die eine Streichung aus dem Mehrwertsteuerregister beinhaltet, aber nicht ausdrücklich die Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer verbietet, zu einer ständigen Unsicherheit hinsichtlich des steuerlichen Status der Steuerpflichtigen und ihrer Verbraucher führen.
Endgültige Entscheidung des Gerichts
Letztlich entschied der EuGH, dass Artikel 213 Absatz 1 und Artikel 273 der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie sowie die Grundsätze der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit es den nationalen Rechtsvorschriften verwehren, den Steuerbehörden zu gestatten, einen Steuerpflichtigen allein wegen der Nichterfüllung seiner mehrwertsteuerlichen Pflichten aus dem Mehrwertsteuerregister zu streichen, ohne zuvor die Einzelheiten der Verstöße und des Verhaltens des Steuerpflichtigen zu prüfen.
Schlussfolgerung
Die Entscheidung des EuGH bedeutet, dass Cityland aufgrund nationaler Vorschriften, die im Widerspruch zur EU-Mehrwertsteuerrichtlinie stehen, zu Unrecht aus dem Mehrwertsteuersystem ausgeschlossen wurde. Insbesondere steht die Sanktion, wie die automatische Abmeldung von der Mehrwertsteuer, nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem Verstoß, vor allem, wenn die Steuerbehörde die besondere Art der Verstöße und das Gesamtverhalten von Cityland nicht berücksichtigt hat.
Daher hat Cityland die Entscheidungen der Steuerbehörden zu Recht angefochten. Darüber hinaus könnte das EuGH-Urteil in diesem Fall dazu beitragen, Unternehmen in der gesamten EU vor unverhältnismäßigen Sanktionen zu schützen, und die Bedeutung eines ausgewogenen Ansatzes bei der Durchsetzung der Mehrwertsteuer im Hinblick auf die Effizienz der Steuererhebung und die Rechte der Steuerpflichtigen unterstreichen.
Quelle: Rechtssache C-164/24 - Cityland gegen den Direktor der Berufungsbehörde und der Direktion für Steuer- und Sozialversicherungspraxis von Veliko Tarnovo, Bulgarien, EU-Mehrwertsteuerrichtlinie

Ausgewählte Einblicke
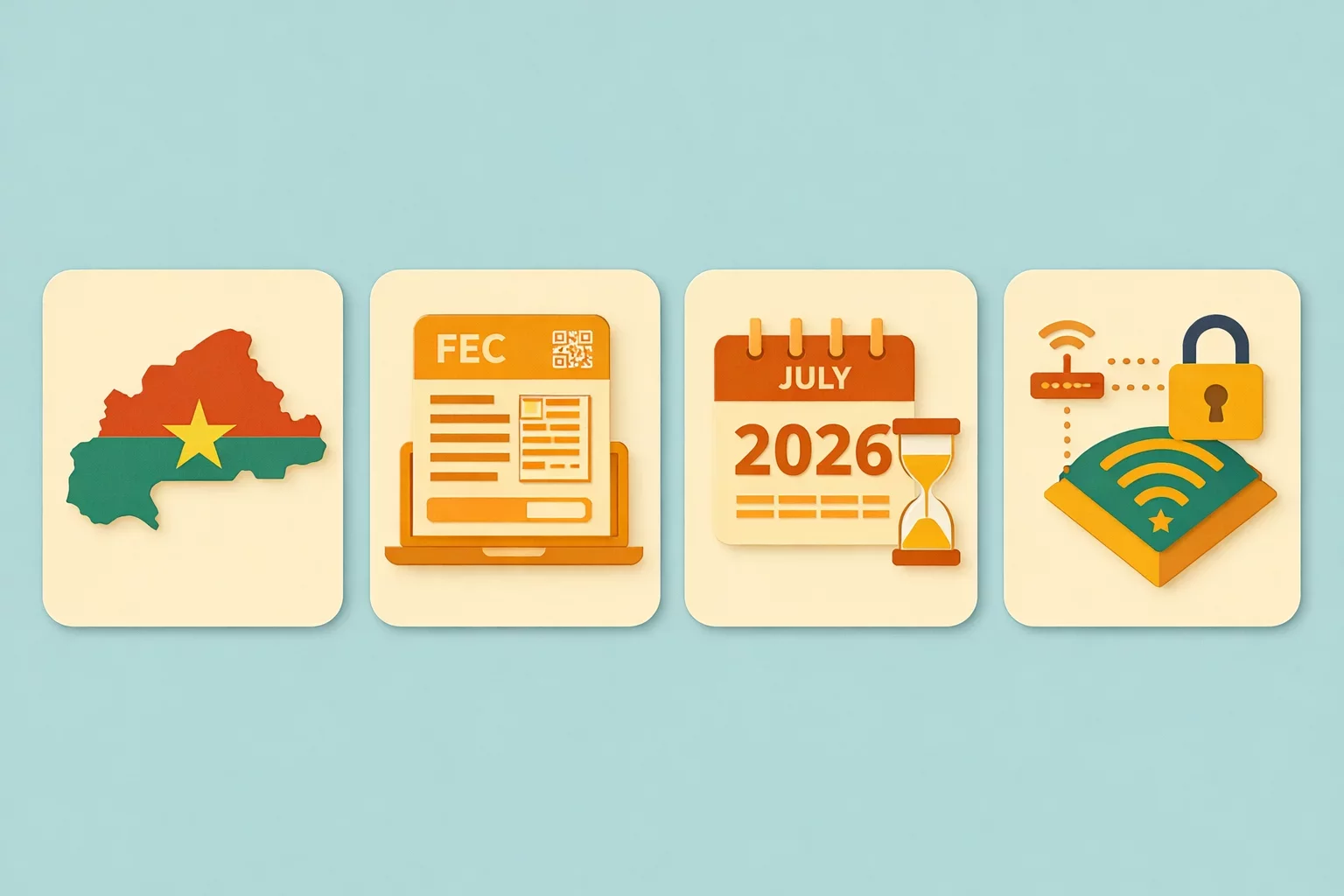
Burkina Faso FEC E-Invoicing Mandatory July 2026
🕝 February 24, 2026
Mehrwertsteuerreform in Mosambik: Digitale Güter und Dienstleistungen ab 2026
🕝 February 17, 2026
Verschwundene Händler und Mehrwertsteuerbetrug: Urteil eines litauischen Gerichts
🕝 February 9, 2026
Kontinuierliches Lernen in Steuer- und Rechnungswesen: Teams für eine schnellere Zukunft aufbauen
🕝 January 27, 2026Mehr Nachrichten von Europa
Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Entwicklungen aus aller Welt, damit Sie informiert und vorbereitet sind.
-e9lcpxl5nq.webp)


-ulcnia30z1.webp)



-3rcczziozt.webp)
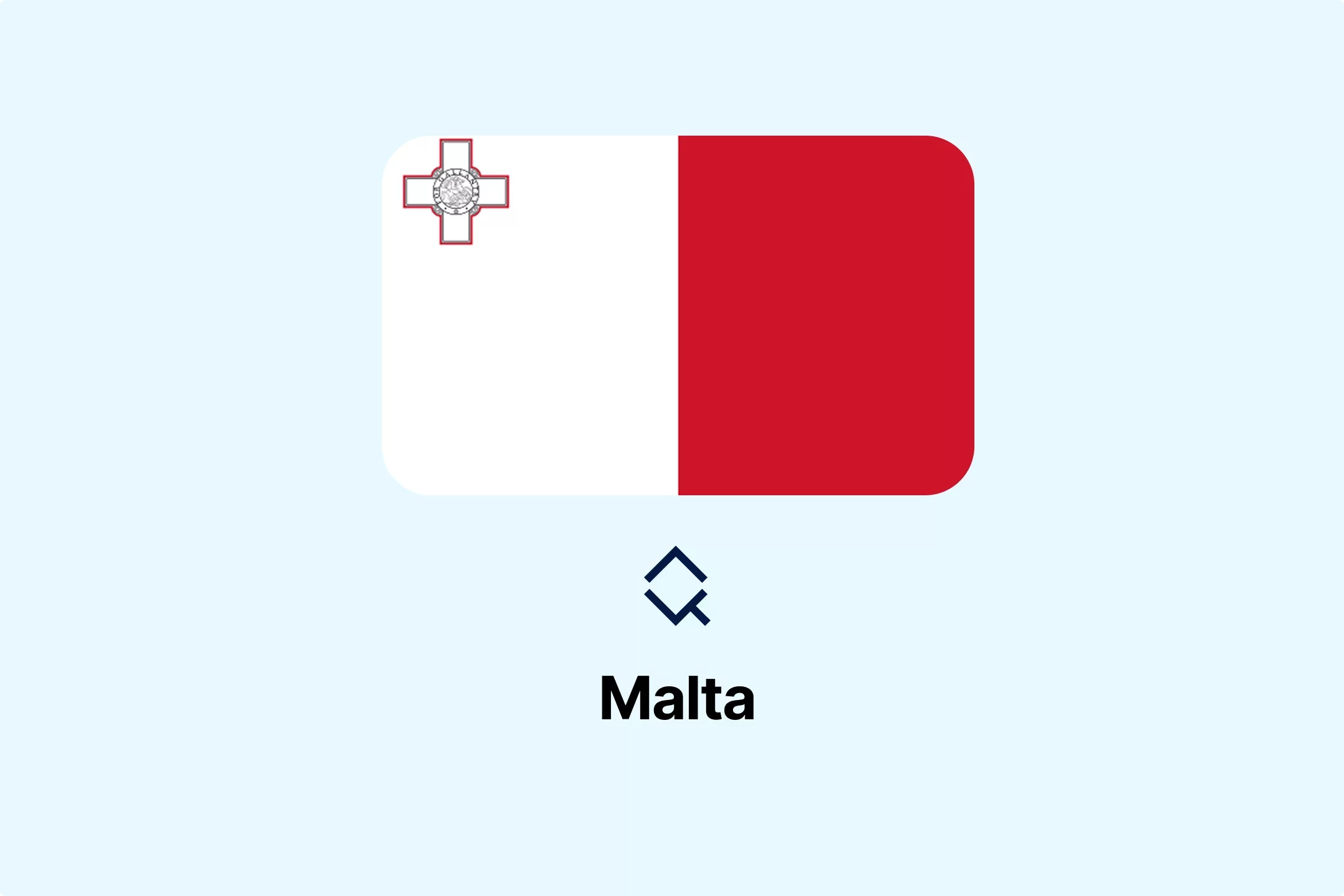
-rvskhoqpms.webp)




-a5mkrjbira.webp)

-ivkzc1pwr4.webp)




-hssrwb5osg.webp)



-c06xa1wopr.webp)
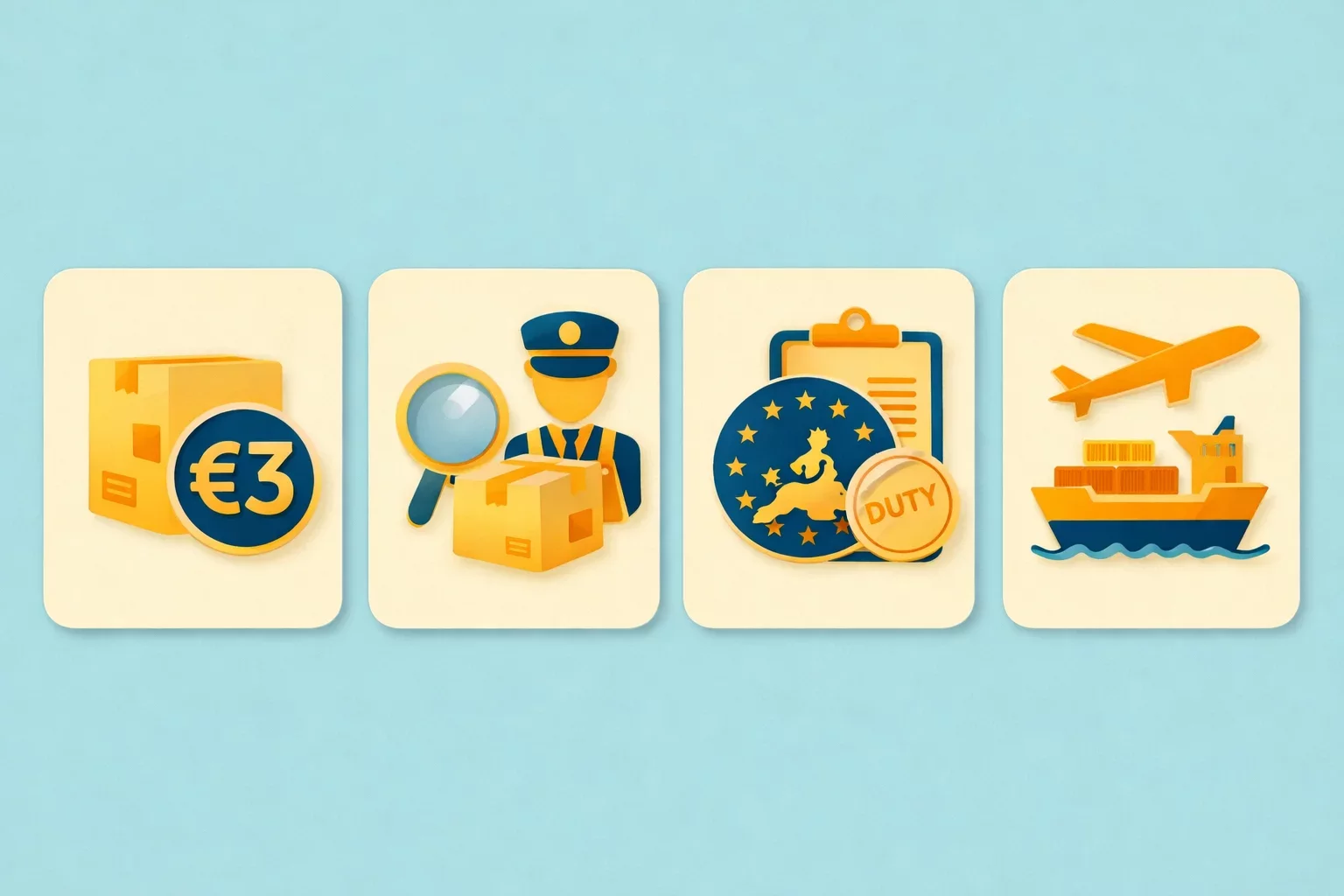


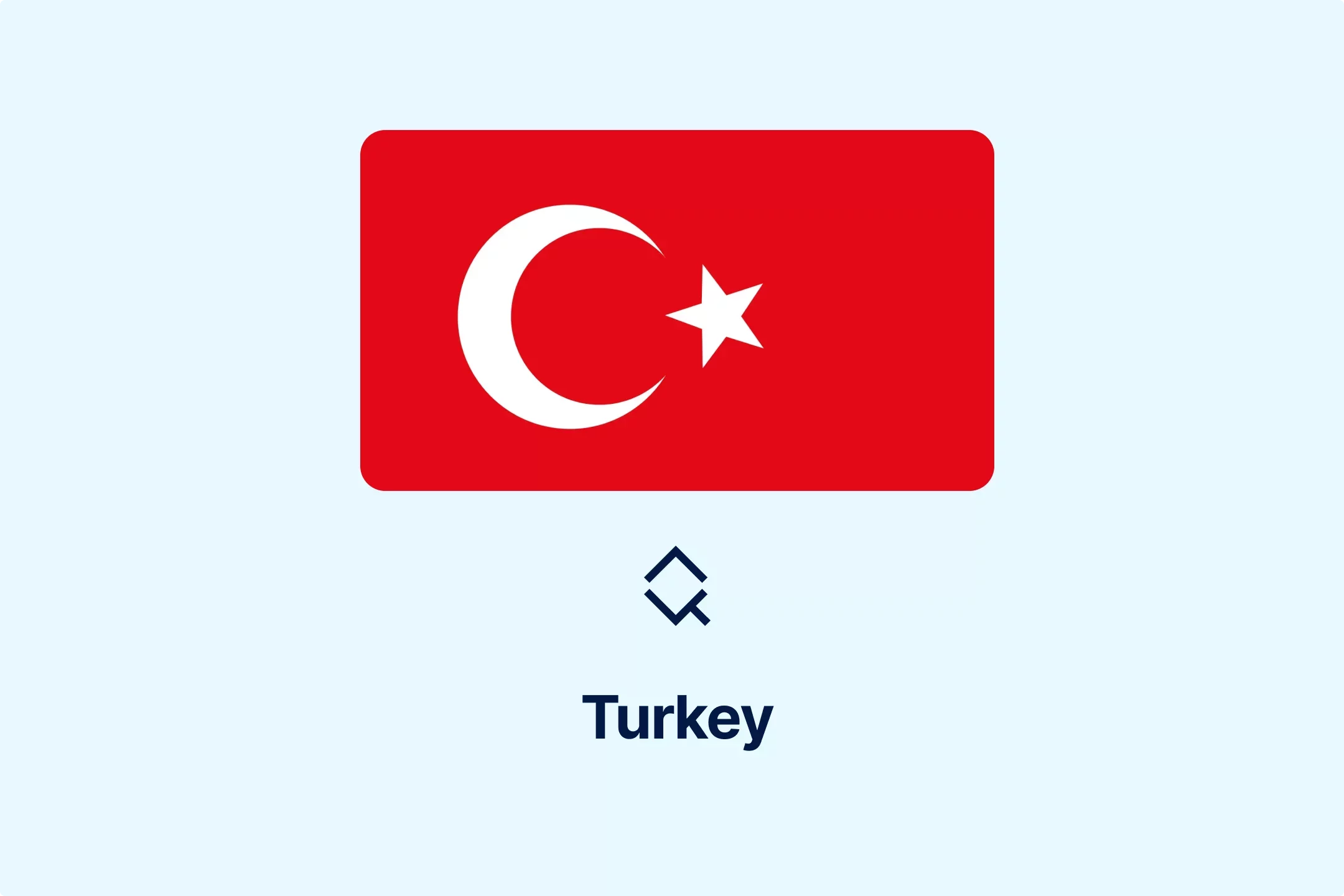




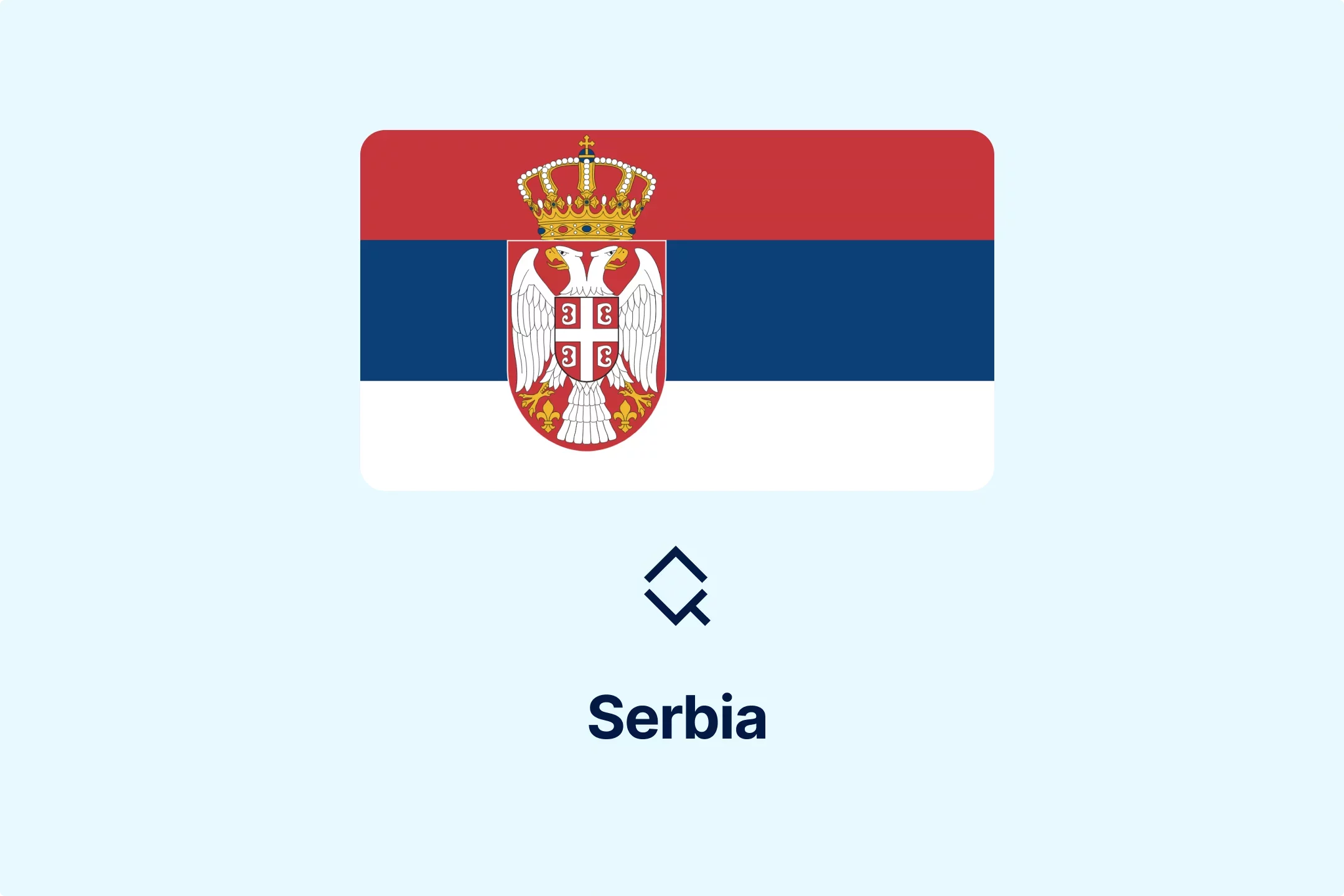
-webajrr4ny.webp)
-evibmwdwcn.webp)
-7acdre0hop.webp)

-lcgcyghaer.webp)
-ol6mdkdowg.webp)
-aqdwtmzhkd.webp)

-njgdvdxe2u.webp)



-i6rki3jbad.webp)
-hdwgtama05.webp)

-atbhy5fyxv.webp)



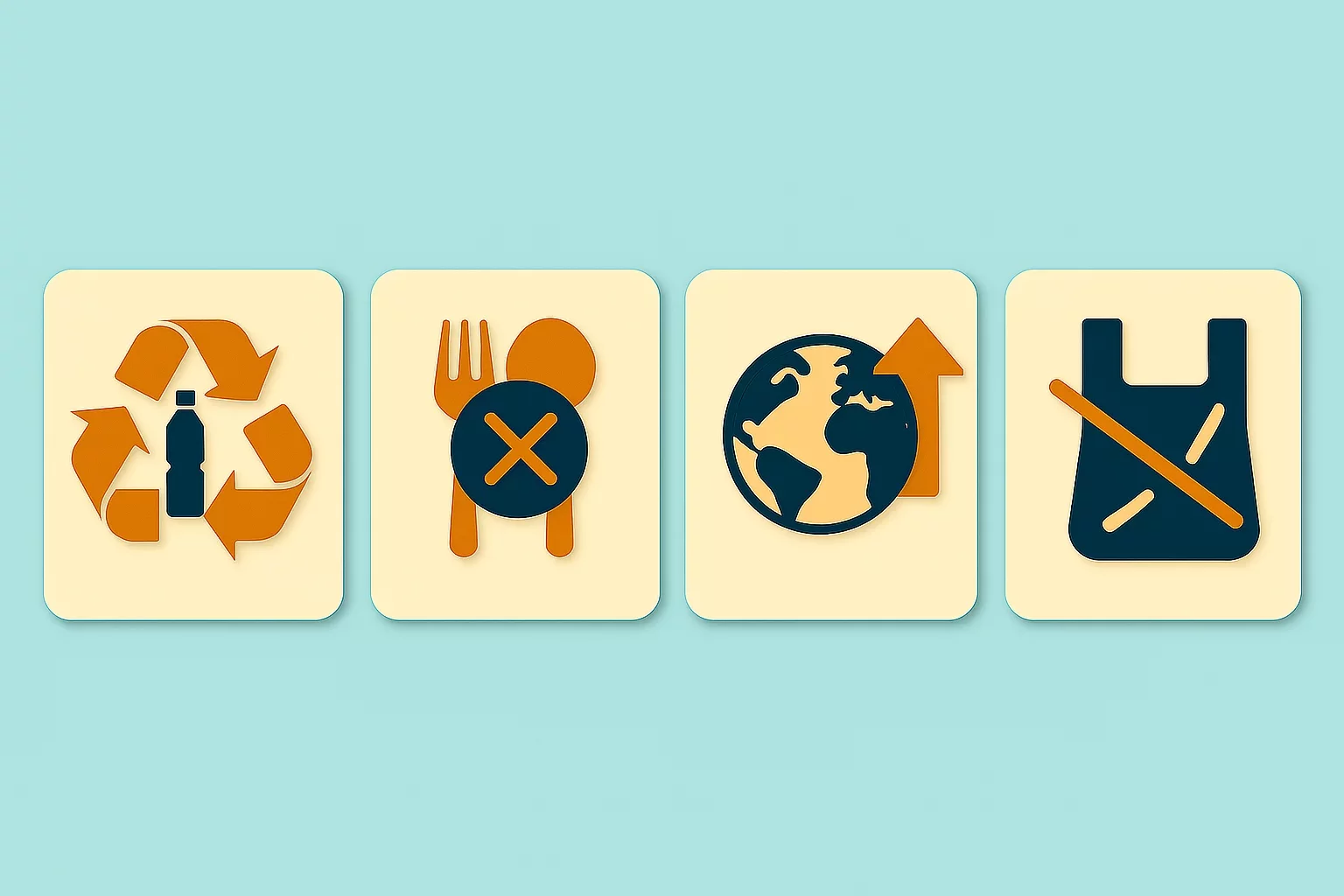


-zp2n6zixoa.webp)
-oa1ynbm4sn.webp)
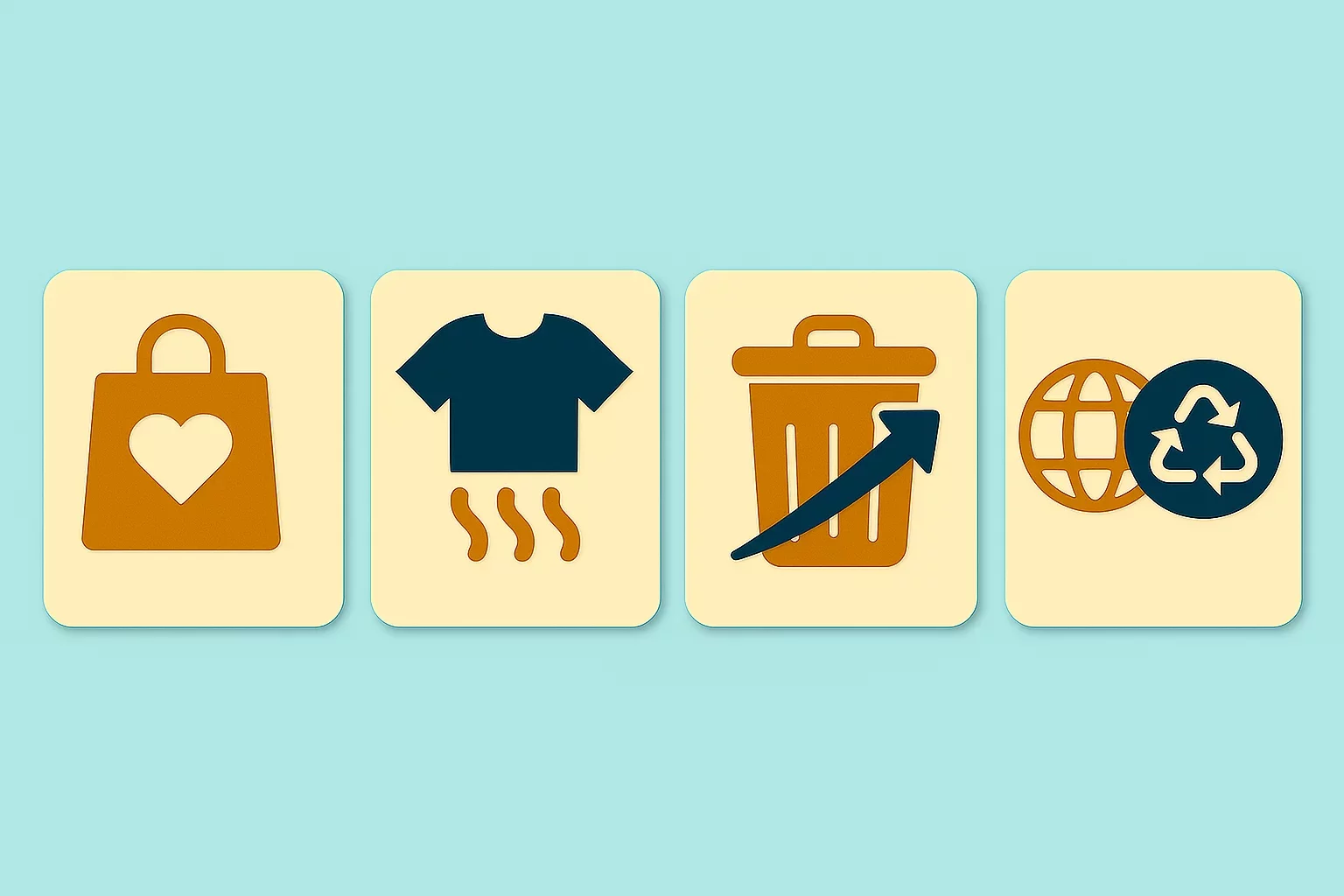

-lltkno6txy.webp)



-do38odrqnq.webp)

-t409oldqzt.webp)

-hordopb6xh.webp)
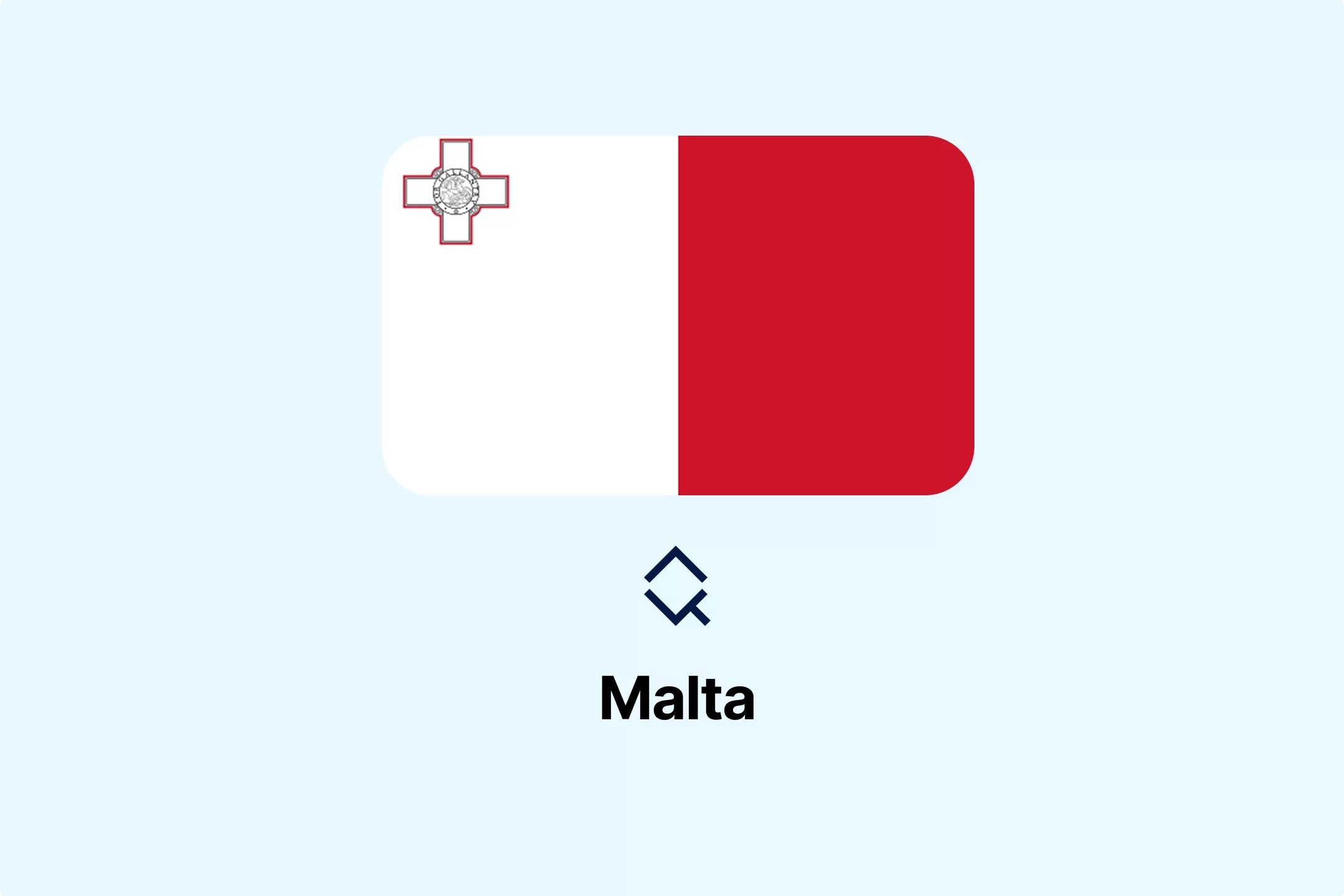
-ooimnrbete.webp)

-lwb5qpsily.webp)


-eumafizrhm.webp)

-mtqp3va9gb.webp)

-3ewrn1yvfa.webp)
-591j35flz2.webp)

-huj3cam1de.webp)
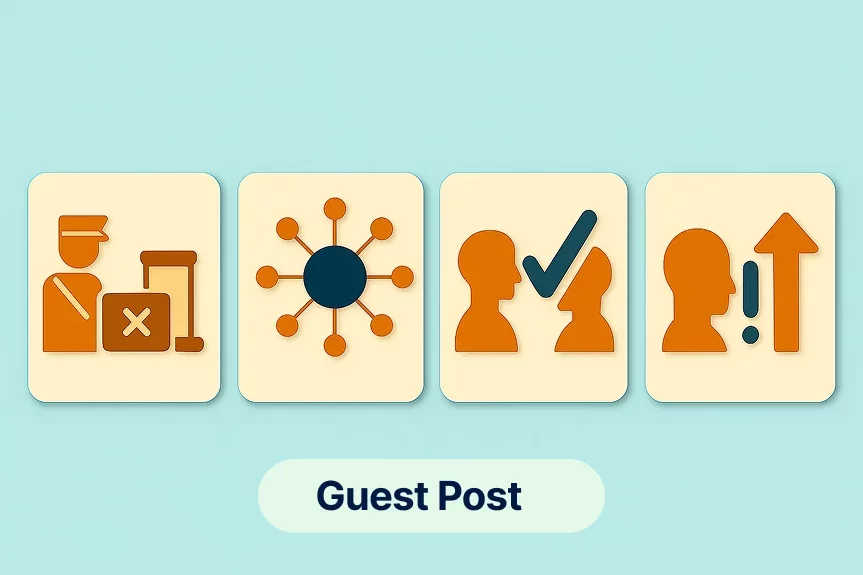

-hafis0ii23.webp)

-qseaw5zmcy.webp)


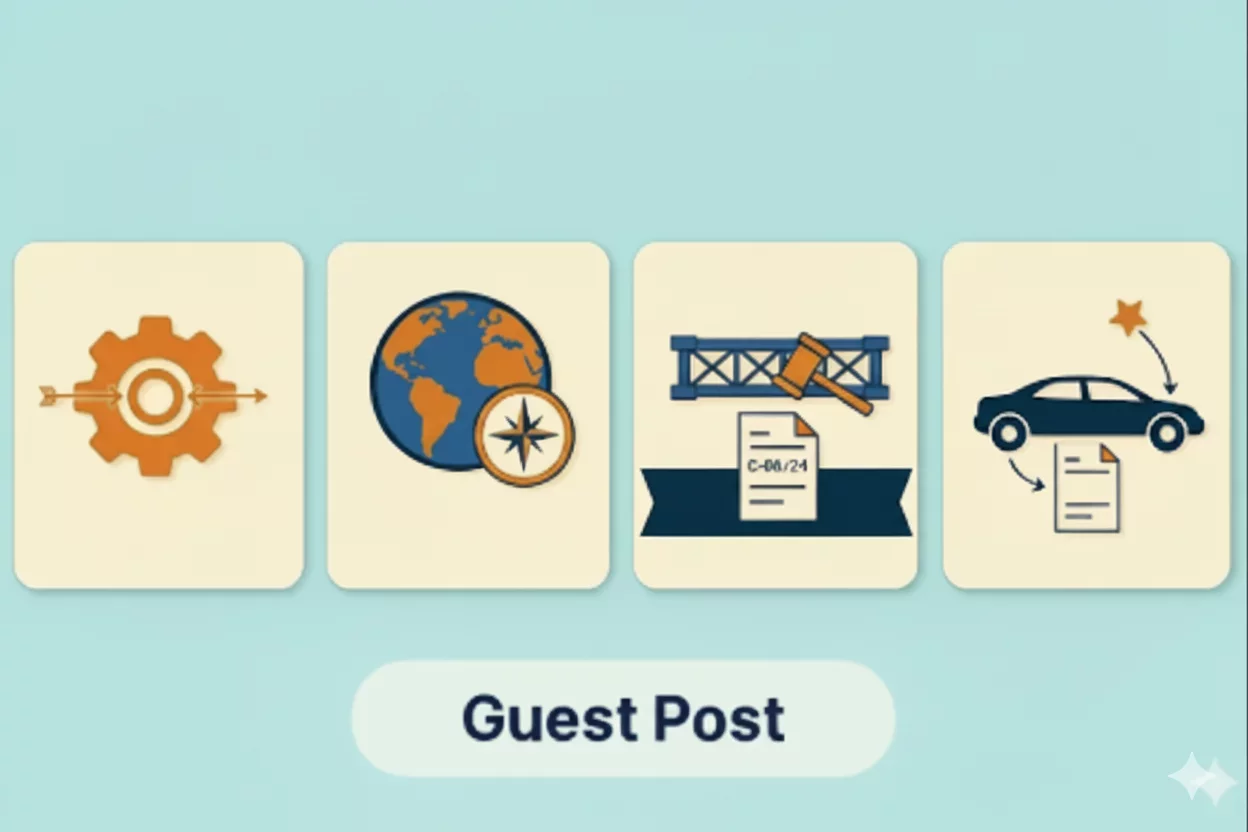
-qzsah2ifqx.webp)


-69rzooghib.webp)
-wrvng98m0g.webp)


-psucycuxh2.webp)
-klyo8bn5lc.webp)



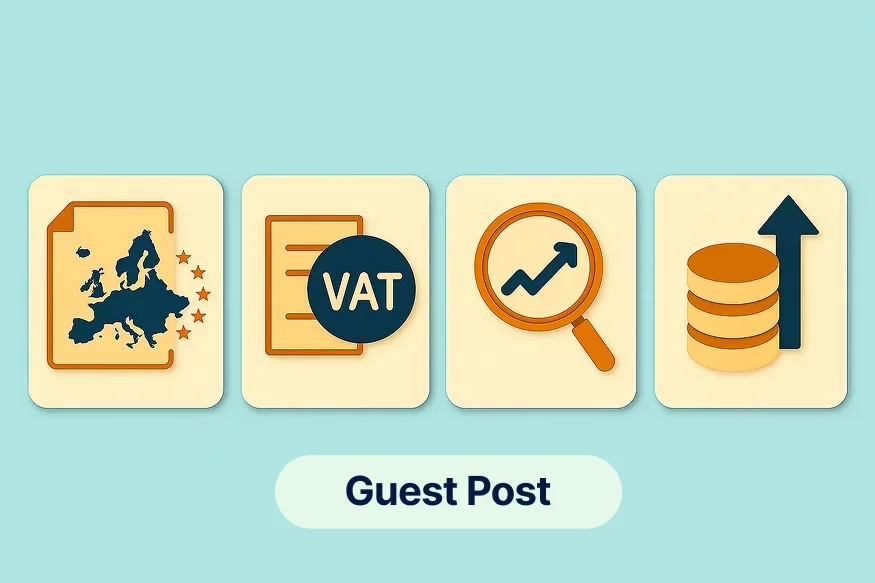
-6wv5h5eyyd.webp)
-tfgg78rbid.webp)
-a6jpv9ny8v.webp)
-qhdbapy0qr.webp)


-owvu7zoc13.webp)

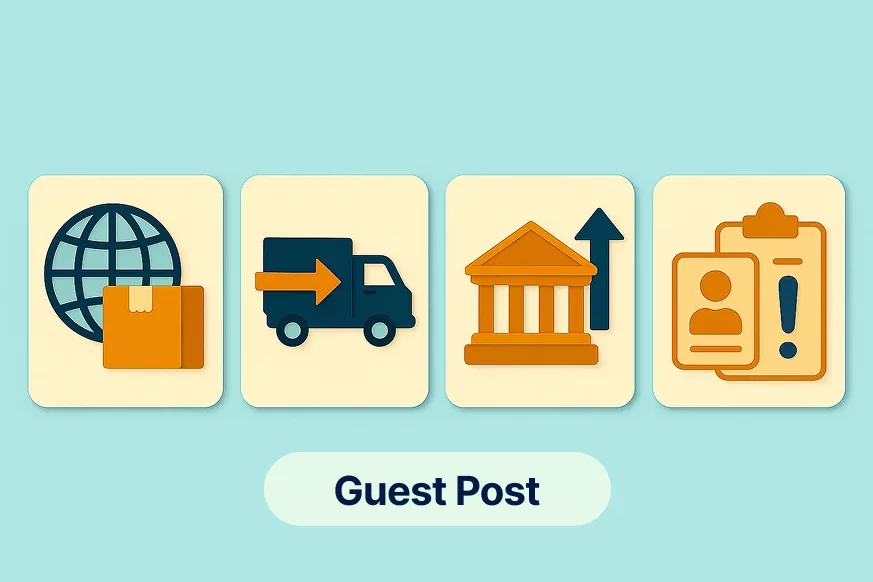
-h28jrh1ukm.webp)

-wl9bl1rw3a.webp)

-2w76jtvtuk.webp)
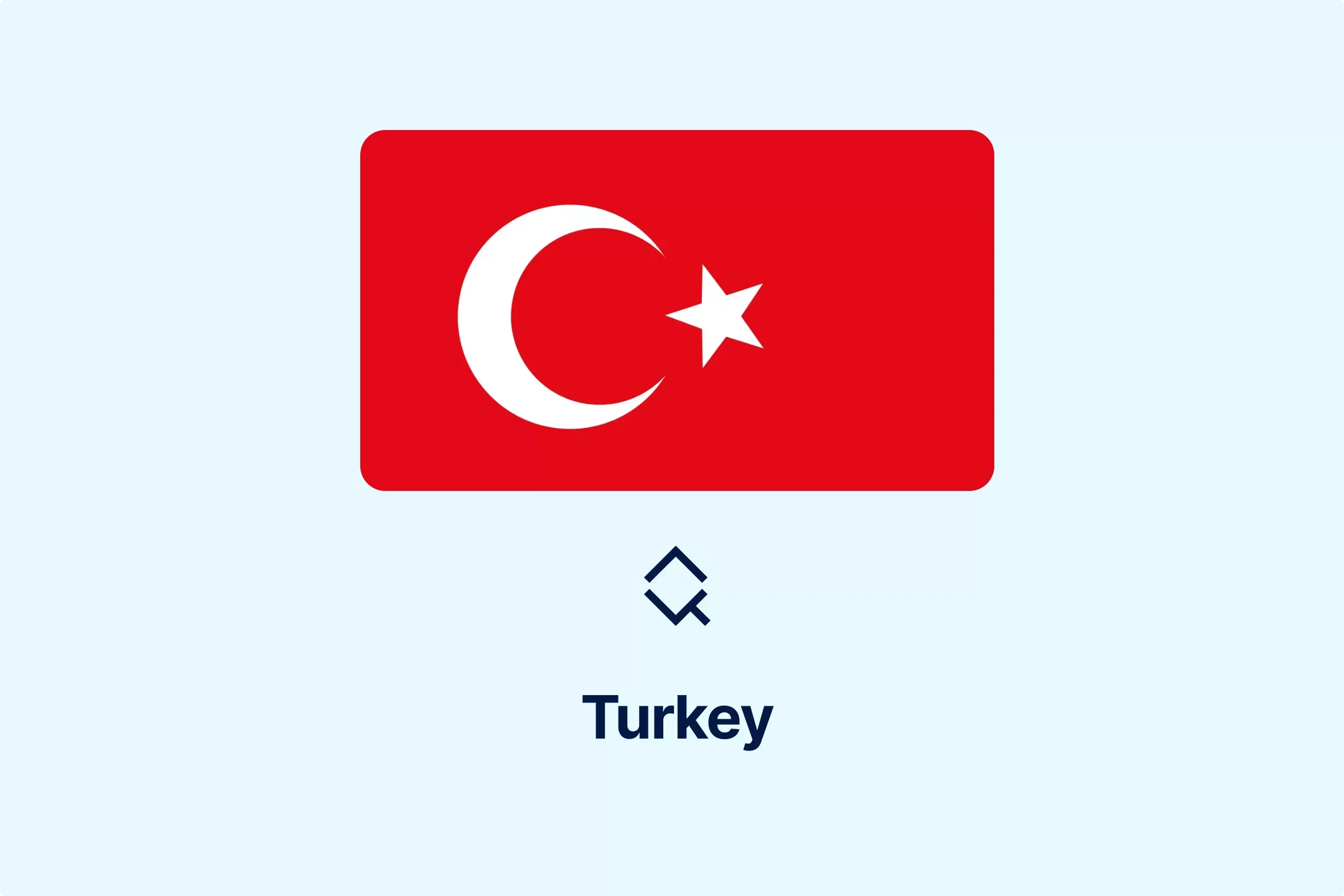
-c0uvrmrq9j.webp)



-pofe7ucwz3.webp)



-5cc23ezxyf.webp)
-rrmabbekeb.webp)








-iyyeiabtaf.webp)
-c8rbjkcs01.webp)
-nilkffjhah.webp)

-hikakq55ae.webp)

-z1d60bldtg.webp)
-d1a0q6n7mp.webp)
-viip8nvoeh.webp)
-bvv1otliox.webp)

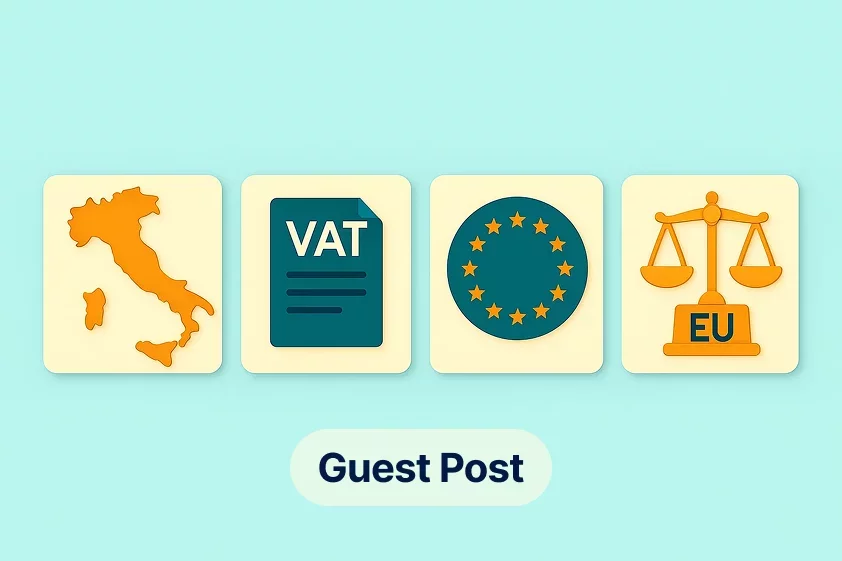

-de8hdb1bn3.webp)
-7xsxxoypnx.webp)

-cm0opezg73.webp)
-0tovsdupmi.webp)
-subxdamdj6.webp)


-gly6ablwnh.webp)
-gkduqhwbzh.webp)
-qpe1ld9vcj.webp)
-8noukwsmba.webp)
-aka29tuhkt.webp)


-fisvs27yrp.webp)


-mp0jakanyb.webp)

-aivzsuryuq.webp)



-o7f4ogsy06.webp)

-zjja92wdje.webp)
-hrbhdts8ry.webp)
-qtdkwpgkug.webp)


-cf8ccgah0p.webp)
-0em3cif5s6.webp)





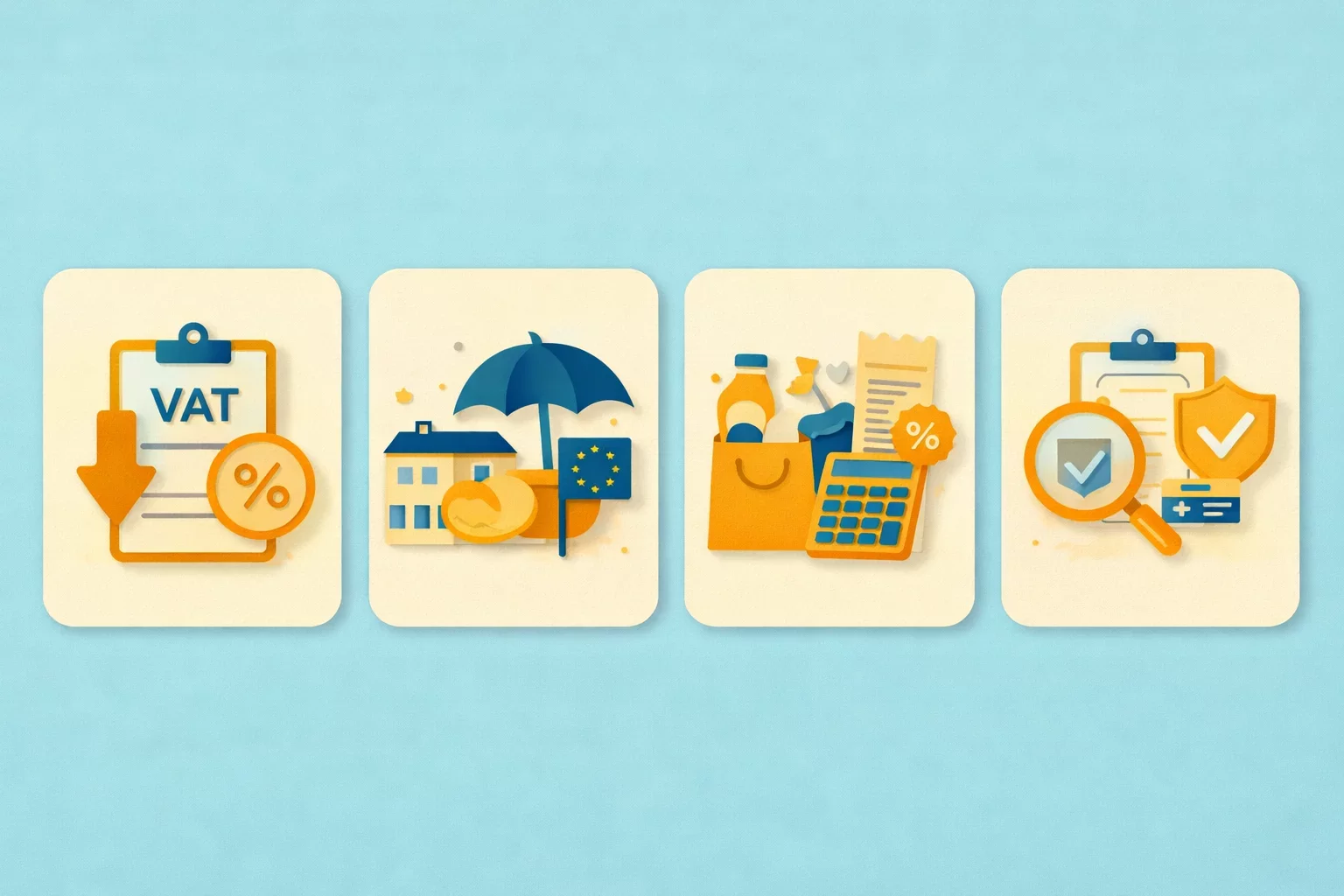
-ptzesl0kij.webp)

-tfzv42pyms.webp)







-uodv7sfbih.webp)
-bbrdfmm9qf.webp)



-m2tl8crfqr.webp)




-1awbqjgpjs.webp)
-avbjsn1k1g.webp)


-0h8ohkx6s0.webp)



-wfmqhtc7i6.webp)
-7wljbof2zo.webp)

-eqt97uyekl.webp)
-wzw9mcf563.webp)

-z4oxr6i0zd.webp)



-l0zcrrzvhb.webp)
-fhtic1pwml.webp)

-iipdguuz9p.webp)
-nkhhwrnggm.webp)
-pltqwerr3w.webp)

-nn6mtfbneq.webp)

-tmnklelfku.webp)



-8z1msbdibu.webp)
-7g16lgggrv.webp)



-lxcwgtzitc.webp)
-9mc55kqwtx.webp)


-xla7j3cxwz.webp)
-jrdryw2eil.webp)






-t9qr49xs2u.webp)


-qjopq5jplv.webp)



-vune1zdqex.webp)

-qsozqjwle2.webp)
-rgjta7iwiv.webp)

-zb6bxxws47.webp)
-lyfjzw4okp.webp)

-ogpfmol5m1.png)


-czisebympl.png)

-zetvivc79v.png)
-ud7ylvkade.png)
-qizq6w2v5z.png)







-ihr6b4mpo1.webp)
-k1j4au0ph6.webp)
-swxxcatugi.webp)


-ig9tutqopw.webp)

-tauoa6ziym.webp)

-spr0wydvvg.webp)

-xfuognajem.webp)





-u2nv5luoqc.webp)








-opuxpan2iu.webp)




-kwttsfd8ow.webp)
-8u14qi10nj.webp)

-wjpr96aq5g.webp)

.png)

.png)


.png)


.png)



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)




.png)
.png)




































































































































